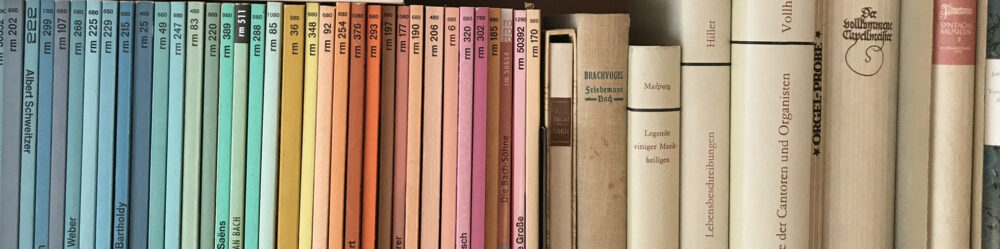Ob ein Superintendens wohl Poete seyn könne? - Zur Person des „Leipziger“ Hauptlibrettisten Johann Sebastian Bachs.
Iterativ dokumentierter Entwurf für ein fiktionales Vortragsmanuskript.
Michael Hochgartz
D 48153 Münster
michael@hochgartz.de
Version: 28.11.2025
DOI: 10.5281/zenodo.15390511
CC BY-NC-ND 4.0
Quelltext, Versionsgeschichte und provisorisches Literaturverzeichnis:
https://github.com/michael-hochgartz/lectio-brevior
KI-basierte Konsistenzprüfung einigerHauptargumente (Fragen an GPT 5)
Ob ein Poete wohl Superintendens seyn könne?
(Erdmann Neumeister, 1704)
Der seine Gottesfurcht mit Wissenschafft vereinet
Und durch Beredsamkeit ein Felsen-Hertz erweichet
(Michael Christoph Brandenburg, 1714)
Jetzt bin ich müd vom Rennen und Laufen
Jetzt will ich mich im Grabe verschnaufen.
Lebt wohl! Dort oben, ihr christlichen Brüder
Ja, das versteht sich, dort sehn wir uns wieder.
(Heinrich Heine, 1851)
Learn the facts - then try on the stories like clothes:
(John Le Carré, 1974)
Man muss dem Gericht natürlich eine stimmige und lebensnahe Geschichte präsentieren, und man kann da auch Schreibfreude entwickeln.
(Hans-Gerd Jauch, 2012)
Bildung lässt sich nicht downloaden.
(Günther Jauch, 2009)
Bei dem Autor der Texte für Johann Sebastian Bachs Choralkantaten des Jahrgangs 1724/25 und für einige von deren Vor- und Nachläufer, für Teile seiner Johannes-Passion und für eine Anfang 1725 abgebrochene Urfassung der Matthäus-Passion handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Lüneburger Lamberti-, Nikolai- und Johannis-Prediger, den 1714 zum Superintendenten und Inspektor der Lateinschule Johanneum und ihres Kantatenchors ernannten Johann Christoph Jauch (1669-1725), den jahrzehntelangen unmittelbaren Zeitgenossen, mutmaßlichen Studienkollegen und späteren theologischen Vorgesetzten, Kanzelredner bei gemeinsam absolvierten Kantatenaufführungen und vielleicht auch Beichtvater von Bachs „Lehrmeister“ Georg Böhm - dem Komponisten der bei Jauchs Beisetzung in St. Johannis am 6. Februar 1725 aufgeführten Trauermusik.
Jauchs Vater Christian (1638-1718) stammte aus dem thüringischen Sulza (D 99518 Bad Sulza) in der Nähe von Jena, wo sich seine Vorfahren seit 1512 nachweisen lassen, seine 1702 gestorbene Mutter Ingeborg Nicolai (von deren 1723 erwähntem Trauergedicht aus der Feder ihres Sohnes bislang kein konkretes Exemplar gefunden werden konnte) aus dem Holsteinischen Husum.
Anlässlich der Übersiedlung seines Vaters nach Lüneburg und dessen Wiederverheiratung am 6.12.1703 verfasste Jauch einen Kantatentext, dessen Komponist durchaus bestimmbar ist und dessen Inhalte als frühester Beleg für die Geschichte dieses Zweiges der Familie betrachtet werden können:
„Die beglückte und gesegnete Herüm- und Zusammenführung Des all weisen Gottes, Welche bey glücklicher Herümführung aus Mecklenburg ins Lüneburgische Land, Wie auch Bey ehlicher Zusammenführung Des S. T. Herrn, Herrn Christian Jauche[n] des Aelteren, Kauff- und Handelsmans hieselbst, Mit der S. T. Frauen, Frauen Dorothea Hoier verwittibten Benckendorffs, An deren erfreulichen Hochzeit-Tage Alß am 6. Decemb. dieses 1703. Jahrs, Zum Zeichen der hertzlichen gratulation aus unterschiedenen biblischen Sprüchen und Exempeln Im Nahmen sämtlicher geliebten Kinder aus kindlicher Pflicht und Liebe vorst[...] und bey einer Musicalischen Harmonie præsentiren wollen, M. Joh. Christ. Jauch, Prediger zu St. Lamberti“
Johann Christoph Jauch wurde am 13. September 1669 im Dom zu Güstrow getauft als Sohn einer Kammerzofe der Herzogin Magdalena Sybilla (geb. von Schleswig-Holstein-Gottorf) und eines „Ersten Lacquayen u. Tafeldeckers“ ihres Sohnes, des zuweilen - besonders nach Aufhebung seiner Tafel - höchstselbst die Laute spielenden Erbprinzen Karl von Mecklenburg-Güstrow.
Dessen Vater, Herzog Gustav Adolf (Dichter von letztendlich 100 regelgerecht gereimten, durch Jauchs lebenslangen theologischen Mentor Johannes Fecht 1699 posthum veröffentlichten geistlichen Dichtungen und als „Der Gefällige“ Mitglied der „Fruchtbringenden Gesellschaft“), förderte durch ein Stipendium die Ausbildung des sprachschöpferisch und rhetorisch überdurchschnittlich begabten Schülers und Studenten, der die Lateinschulen in Güstrow, Wismar und Schwerin besuchte, wo er unter Anleitung namentlich ermittelbarer Pädagogen und Musiker, „durch deren treue Anführung er so wol in dem Christenthum als Sprachen dergestalt zugenommen, daß er von der andern [Unterprima] classe mit Nutzen zu der Obersten [Oberprima] schreiten können“, eine theologische und humanistische Elementarbildung erhielt und zugleich - wie an solchen jahrhundertealten Bildungsinstitutionen z.T. bis heute üblich - Erfahrungen als Chorsänger gemacht haben dürfte.
Eine erste Förderung hatte Jauch durch die Eltern erfahren, die „bey zarter Jugend ein herrlich ingenium bey diesem ältesten Sohne verspüret“, und es war „ihre erste Sorge, wie sie ihn zu allem guten anführen, und zur Ehre GOttes auferziehen mögten“.
Die im Februar 1689 auf Veranlassung des Rektors der Domschule Güstrow gedruckte Einladung zur öffentlichen Darbietung einer lateinischen Oration anlässlich des Geburtstags seines Landesherrn ist das früheste Indiz für die sprachgestalterische Kompetenz des damals 19jährigen Jauch, der bei dieser Gelegenheit als „Praestantissimus Juvenum“ bezeichnet wurde.
Erst nach einer - zunächst nur pro Forma erfolgten - Immatrikulation an der Universität Rostock wechselte Jauch im April 1689 zum Grundstudium der Philosophie nach Jena. Offenkundige Motivation für diesen Umweg war die Absicht, die dort (in Jena) praktizierten, überregional berüchtigten, menschenverachtenden Depositionsrituale für Erstinscribenten zu umgehen. Als Studienort war Jena sicherlich auch prädestiniert aufgrund des in der unmittelbaren Umgebung lokalisierten familiären Umfelds.
Nach einem - spätestens Anfang 1694 beendeten - Aufenthalt in Leipzig (bei dem er zufällig durchaus E. Neumeister, J.B. Carpzov, J. Schelle, J. Kuhnau oder J.A. Stübel begegnet sein könnte) beschloss [J]ohann [C]hristoph [J]auch seine - vor allem durch gedruckte, personenbezogene „Beiträge“ in gebundener Rede recht engmaschig verfolgbare - akademische Ausbildung 1695 in Rostock in der ehrenvollen Form als Praeses einer Disputation seines Kommilitonen Daniel Sasse (wo er sich mittels der Invocatio [J]esu [C]hristo [J]uvante auch im Titulus zu erkennen gibt) unter Betreuung durch den fast gleichaltrigen, früh verstorbenen Danziger Theologen, Gräzisten und Kieler Kortholt-Schüler [J]ohann [G]ottlieb [M]öller (1670-1698), der etlichen seiner sonstigen gedruckten Disputationen die Formeln [J]esu [G]ratia [M]oderante oder [I]n [G]loriam [M]ediatoris oder auch [J]mmensi [G]loriam [M]ediatoris voranzustellen pflegte.
Die Wahl des Themas hatte möglicherweise den Beweggrund, dem für ein alsbald anzutretendes bürgerliches Predigtamt bestimmten Jauch ohne hinreichende schriftliche Vorleistungen eine akademische Befähigung zu attestieren. Denn: inhaltlich ging es um die Diskussion der Legitimität von nicht-examinierten „Laien“ (das bezog sich entgegen heutigem Sprachgebrauch nicht auf Theologen, sondern primär auf Philosophen) für eine - frühe Dogmen betreffende - Entscheidungsfindung während des I. Konzils von Nicaea - und zwar ohne dass diese Teilnehmer selbst einer formellen „Disputation“ unterworfen wurden. Somit wohnt dem Ganzen eine - heute kaum verständliche - Selbstbezüglichkeit innerhalb der lutherischen Spät-Scholastik inne. (Johann Gerhard, Martin Chemnitz, Abraham Calov u.a.)
Unter Möllers Führung hatte Jauch „als der erste und liebste“ von sechs per Pedes Apostolorum mitreisenden Studiosi am Ziel einer von Juli bis September 1694 währenden, vom nachmaligen Rostocker Universitätsbibliothekar und Poetik-Professor Carl Arndt sorgfältigst (unter dem Titulus „I.N.I.A.“) dokumentierten theologischen Exkursion (die später so benannte „Preußische Reise“) durch Pommern, Ostpreußen und Brandenburg kurz vor dessen Tod den Frühaufklärer Samuel von Pufendorff in Berlin heimgesucht.
Leider wurde bei der Publikation des auch heute noch lesenswerten „Diariums“ (vgl. Kohlfeldt 1905) mehr Wert auf die - zweifelsohne interessanten - kulturhistorischen Aspekte der Tour gelegt und die angeblich schwer zu entziffernden Diskussionen mit den besuchten Theologen ausgelassen. Sie dürften aber durch das handschriftliche Original zu ergänzen sein. Stichproben anhand einer Parallelquelle lassen erhoffen, dass es mehr um akademischen Smalltalk ging als um dogmatische Auseinandersetzungen.
Es ergibt sich die Überlegung, ob die drei Jahrzehnte nach diesem Ereignis in Leipziger Kantatentexten anzutreffenden rationalismuskritischen Floskeln - z.B. in BWV 2 („Und was der eigen Witz erdenket, … der eine wählet dies, der andre das, die törichte Vernunft ist ihr Kompaß“), BWV 178 („Schweig, schweig nur, taumelnde Vernunft“) und BWV 121 („Was Wunder, daß allhie Verstand und Witz gebricht“), aber auch - syntaktisch recht verstanden - BWV 180 („noch durch Vernunft das hohe Werk ergründet“) ihren Urgrund in diesen prägenden Begegnungen hatten und inwieweit sie ferner als aktuelle unterschwellige Kommentare des Autors zu den seit 1723 eskalierenden Kontroversen um den Philosophen Christian Wolff zu interpretieren sind. (Vgl Fischer 2017.)
In wieweit sich im Subtext von BWV 178 (zum 30.7.1724) überdies Anspielungen auf kontroverstheologische Diskussionen, speziell auch zu dem - schwerpunktmäßig von Vertretern des Pietismus besetzten - Thema Terminismus, belegen lassen, bleibt (auch anhand weiterer Kantatentexte) zu untersuchen und hängt zum Beispiel davon ab, ob das „stets“ in Bezug auf einen für jedes Individuum definierten letztmöglichen Gnadenzeitpunkt („terminus preremptorius“) nur versmetrisch (8.8.9.9.8.8) oder auch theologisch begründet werden kann, dessen Verpassen „die Frommen […] verlorn“ sein lässt. Die Hoffnung auf eine jederzeit mögliche geistliche Neugeburt „nur“ (hier nicht beschränkend gemeint, sondern im Sinne von „einzig und allein“; also als syntaktisch verstellte Partikel zu „Kreuz“, nicht als Adverb zu „geborn“; möglicherweise ebenfalls versmetrisch erforderlich) durch Christi historisch/heroischen Kreuzestod wird jedenfalls dogmatisch zweifelsfrei bekräftigt und für die lieben Einfältigen leichter rezipierbar gemacht.
Sprich nicht: die Frommen sind verlorn,
das Kreuz hat sie nur neu geborn.
Denn denen, die auf Jesum hoffen,
steht stets die Tür der Gnaden offen;
und wenn sie Kreuz und Trübsal drückt,
so werden sie mit Trost erquickt.
Zudem steht die von Bach vertonte Fassung in völliger inhaltlicher Übereinstimmung mit den wesentlichen Aussagen in Strophe VI des zugrunde liegenden, metrisch wohl korrumpierten Chorals (Justus Jonas 1524, nach Ps 124):
Ach Herr(e) Gott, wie (reich) tröstest du,
die gänzlich sind verlassen:
der Gnaden Thür steht nimmer zu,
Vernunft kann das nicht fassen.
Sie spricht: es ist nun alls verlorn;
da doch das Kreuz hat neu gebohrn,
die deiner Hilf erwarten.
Durch Verzicht auf je ein Wort ließen sich die beiden Binnenzeilen des Kantatensatzes zu einem in Kirchenliedern allgegenwärtigen Schema 8.8.8.8.8.8 simplifizieren, allerdings um den Preis eines Verzichts auf das „stets“.
Denn denen, die auf Jesum hoffen,
steht stets die Tür der Gnaden offen;
Denen, die auf Jesum hoffen,
steht die Tür der Gnaden offen;
Dass die beiden Zeilen dadurch ins trochäische Versmaß fallen würden, ließe sich - zusätzlich zum Befund des Textes von 1524 - so deuten, dass die vertonte Gestalt die semantisch ursprüngliche ist.
Der theologisch bedeutsame Schlüsselbegriff „stets“ wird von Bach musikalisch durchaus bemerkenswert behandelt: Bei der Wiederholung der betr. Zeile der - ansonsten hier überwiegend kleinzählig rhythmisierten - Tenor-Partie setzt der Komponist einen theologisch intendierten Akzent durch einen vorgezogenen Schwerpunkt (also ohne das vorangehende, sich gleichfalls als Zielpunkt anbietende „steht“) in Form einer in den Folgetakt übergebundenen, fast überdehnt erscheinenden Halbenote.
Derartige musikalische Finessen dürften auf autonomen, spontanen Entscheidungen während des Kompositionsprozesses beruhen. Es ist alles andere als naheliegend, in solchen Fällen eine detaillierte Absprache mit dem Text-Autor zu unterstellen - denn wie hätte diese unter allen obwalteten Umständen praktisch bewältigt werden können?
Als vorläufiges Fazit der bisher angeführten, exemplarischen Beobachtungen ist festzuhalten, dass Johann Christoph Jauch, auf dem Boden der norddeutschen lutherischen Orthodoxie fußend, sich um ein kritisches Verhältnis sowohl zum Rationalismus (nach Justus Jonas: „Vernunft kann das nicht fassen“) als auch zum Pietismus („der Gnaden Thür steht nimmer zu“) bemüht hat, also jenen beiden zunehmend mitbestimmenden Strömungen, von denen sich die erstere im Verlauf des späten 18. und gesamten 19. Jahrhunderts als führendes theologisches Paradigma erweisen sollte, während letztere ihren Einfluß eher auf dem weiten Feld individualistischer, gleichwohl strukturell wirksamer, gleichwohl regional eingehegter Lebens- und Glaubenspraktiken entwickelte.
Wichtigster Förderer Jauchs während seiner Rostocker Zeit war zunächst und auch später jener erwähnte Theologe Johannes Fecht, der als Theologieprofessor, Universitätsrektor und Superintendent gewissermaßen in - wenn auch nicht unmittelbarer - „akademischer Sukzession“ zu dem als Stichwortgeber für bis zu sieben Sätze von Bachs Matthäus-Passion sowie je eines Satzes der Kantate BWV 2 und der Johannespassion geltenden Heinrich Müller stand.
Fecht - dessen mehr als 10 Bände umfassender Manuskriptnachlass in Rostock, Hamburg und anderswo ebenso einer wissenschaftlichen Auswertung harrt wie auch der Katalog seiner 1742 stückweise versteigerten Bibliothek - war ein engagierter Vertreter der Norddeutschen Reformorthodoxie und - nach anfänglicher Sympathie um so entschiedenerer - Gegner der Radikalpietisten Philipp Jacob Spener und August Hermann Francke.
Die von deren Initiativen ausgelösten „Leipziger Unruhen“ hatten eine Fernwirkung auch in Lüneburg hervorgerufen durch die Person des Superintendenten Johann Wilhelm Petersen, der schließlich 1692 unter minutiös (sowohl von ihm selbt als auch durch die handelnden Institutionen) dokumentieren Umständen aus dem Amt entfernt wurde. Mit diesem - durch einen kirchenmusikalischen Eklat begleiteten - Fanal war jeglichen unorthodoxen Ansichten in Lüneburg bis weit in das 18. Jahrhundert hinein (vielleicht bis heute?) ein Riegel vorgeschoben worden - allenfalls bis zum Aufkommen jener rationalistisch angehauchten Theologie, die sich - wie anderswo auch - im Zuge der Spätaufklärung als communis opinio etablieren sollte.
Jauchs früheste Begegnung mit dem Themenbereich einer natürlich denkenden, von rationalen Erkenntnisweisen inspirierten Theologie (vgl. Zedler 23/987) ist belegt durch seine Rolle als einer von 14 Disputierenden bei einem im August 1692 (also noch während seiner Jenaer Zeit?) stattgefundenem „Discursus academicus ... ex Theologia Naturali“ des Rostocker Nikolai-Pfarrers, Professors für Griechisch, Universitätsrektors und nachmaligem Lüneburger Superintendenten Gottfried Weiß (direkter Nachfolger Petersens), dessen wissenschaftstheoretische Tendenz noch näher zu analysieren wäre. Weißens Wahlspruch weist jedenfalls in eine eindeutige Richtung: „Ich hasse die Fladder-Geister und meine Seele ist ihnen gram.“ (Vgl. Luthers Randglosse zu Ps. 119 sowie das Incipit von BWV 181 und Lehms 1711, 3. Advent.)
Der gedruckte Text (VD17 12:150552A) einer Disputation unter Leitung seiner Mentoren Johann Gottlieb Möller und Johannes Fecht, bei der Jauch am 7. März 1694 als „Respondent“ auftrat, lässt sich nicht sicher als schriftliche Vorleistung für einen Magistertitel kategorisieren (gewiss keine „Dissertation“ im heutigen Sinne.) Gleichwohl ist auch hier das Sujet von Interesse: Die Diskussion der Verhältnisbestimmung zwischen Offenbarung und Vernunft auf der Grundlage einer zunehmd kritisch zu befragenden Bibel.
Eine von Bertram als „Specimen“ (Probestück) angeführte öffentliche Darstellung der Braunschweigisch-Lüneburgischen Reformationsgeschichte am Beispiel des „Corpus Doctrinae Julii“ hat offenbar keinen Niederschlag in einer gedruckten Publikation gefunden.
Der 1695 zu Jauchs Abschied aus Rostock gedruckte Valedictionsbrief der - leider nicht namentlich genannten, aber teilweise ermittelbaren - „sämptl. Haußgenossen“ (ganz oder teilweise identisch mit den Mitpilgernden der „Preußischen Reise?) seines akademischen Ziehvaters Möller ist geprägt durch Analogien bei der Betrachtung von Beziehungen zwischen Kunst, Künstler, Tugend und Natur - dargestellt anhand eines optisch beeindruckenden chemischen Experiments, welches aus anorganischen Substanzen organisch wirkende, baumartige Gebilde wachsen lässt. („Arbor Dianae“). Die letzten beiden der nachfolgend daraus auszugsweise zitierten Zeilen belegen den Übergang von einer mythologischen zu einer neuzeitlichen, bis heute gültigen Erklärweise - und damit den Paradigmenwechsel der Naturwissenschaften um 1700 schlechthin:
Hie steht sein Baum, und zeigt den schönen Wipfel
Dran die gelahrte Welt erwünschte Freude sieht;
Die Ehre zweiget sich umb den erhöhten Gipfel
Der auch bey späten Herbst, als frischer Lorbeer blüht:
O glückliche Chymie, die solchen Baum gebohren
Der Hesperinnen [Hesperiden] Ast hat seinen Ruhm verlohren.
In Band 9/365 der Gesamtausgabe der Werke Immanuel Kants liest sich das Experiment so: „Der Arbor Dianae wird gemacht, wenn Mercurius [Quecksilber] im Scheidewasser [Salpetersäure] und Silber auch besonders [separat] im Scheidewasser aufgelöst wird, darauf diese Solutiones [Lösungen] vermengt und bis auf ein Drittheil im gelinden Feuer eingetrocknet werden; da sie dann einen Baum mit Stamm, Ästen und Zweigen vorstellen.“
Bereits Jauchs Landesherr und früher Förderer, Herzog Gustav Adolf, war bekannt geworden durch außergewöhnliche aufklärerische Tendenzen. Er veranlasste eine umfassende Schulreform und eine zentrale rechtliche Neureglementierung lokal ausufernder „Hexenprozesse“. Der Verbreitung magischer Praktiken begegnete er mit der kostenlosen Abgabe von Medikamenten. 1682 wurden auf seinen Befehl „Zauberbücher“ landesweit konfisziert und verbrannt.
Ob Jauchs „herzbewegliche Worte“, von denen 1712 im Zusammenhang mit dem in eine Schieflage geratenen Großprojekt des vergeblich aufstrebenden Lüneburger Verlegers Johann Georg Lipper berichtet wird, auf eine Wertschätzung auch der Inhalte dieses ambitionierten Prachtwerks schließen lassen, bleibt anhand der Ratsakten näher zu untersuchen. Lipper hatte versucht, mit Hilfe hoher, wiederholt aufgestockter öffentlicher Kredite und in Konkurrenz zu seinem ehemaligen Arbeitgeber Johann von Stern, eine erweiterte, mit Kupferstichen bebilderte Neuauflage der „Mathesis Mosaica“ (geplanter Gesamttitel: „Mathesis Biblica“) des Kieler Universalgelehrten Samuel Reyher zu monetarisieren. 18 Ballen (zu 500 Druckbogen) wurden in einem „Gewölbe“ mit Beschlag belegt, zu dem Jauch die Schlüssel treuhänderisch verwahrte. Im Katalog seiner nachgelassenen Bibliothek findet sich mehr als ein halbes Jahrhundert später unter der Nr. 209 ein Exemplar des ersten (und offenbar einzig erschienenen) Bandes der 1714 (im Jahr der Ernennung Jauchs zum Superintendeten) schlussendlich vorgelegten Ausgabe.
Geistesgeschichtlich bewegte Reyher sich in einer Grauzone, in der biblisch beschriebene Naturphänomene (wie z.B. „Von dem Regenbogen …) mit zeitgenössischen, also nicht immer heutigen Ansprüchen genügenden, damals aber durchaus als wissenschaftlich empfundenen Erklärweisen vermengt werden („… und den durch Kunst [also wohl durch ein Glasprisma] angestellten Regenbogen-Farben“). Reyhers lebenslanges methodisches Manko bestand auch bei diesem Werk (trotz sinnvoll erscheinender Großgliederung) in seinem Hang zur kaleidoskopartigen Facettierung von fragmentarischen Einzelaspekten, und Lipper bot als entlaufener Buchhalter keineswegs eine Gewähr für den unternehmerischen Erfolg eines Titels, der wegen der hinzugekauften Kupferstiche einen hohen Einsatz von Fremdkapital erforderte. (Vgl. Dumrese/Schilling 1956 sowie ADB 28/1889)
Da eine, vielleicht geplante, aber nie zustande gekommene Bestallung (vgl. Stieber 1745; Willgeroth 1924) als einer von üblicherweise mehreren, naturgemäß konkurrierenden (da zugleich als personenbezogene Beichtväter amtierenden) Hofpredigern in Güstrow durch das seit dem Tod des Erbprinzen Karl 1688 an den Pocken erwartbare, im Oktober 1695 mit dem Dahinscheiden des letzten Herzogs Adolf eingetretene Erlöschen der dynastischen Linie gegenstandslos geworden war, wurde Jauch „nach gehaltener Abschieds-Predigt in der Schlosskirche gnädigst dimittiret“ (also dem damaligen, recht überschaubaren Arbeitsmarkt überlassen) und im Verlauf eines offenbar wohlwollend forcierten Magisterexamens auf Initiative des nicht ganz zufällig (nämlich wegen Früh-Immatrikulation seines Sohnes) in Rostock weilenden Lüneburger Bürgermeisters und Pro-Consuls Ludolph von Stöterogge („ein grosser Gönner der Gelehrten“) als Diakonus (Inhaber der Zweiten Pfarrstelle) an die dortige Lambertikirche berufen - unter aktenkundigen Begleitumständen, die auf strukturell bedingte, lebenslange Misshelligkeiten im Verhältnis zu einigen seiner Kollegen vorauswiesen.
So wurde Jauch aufgegeben, eine Probepredigt zu halten über „Hos XIII, 9 Israel du bringst dich in Unglück … bey mir.“ (Die sinnverändernde Auslassung „…“ steht exakt so in der Personalakte). Jedem bibelkundigen Zuhörer oder Mitleser musste aber bewusst sein, dass die anschließenden Verse 10 und 11 in frappierender Weise auf die aktuelle berufliche Situation des Prüflings - nämlich als stellungsloser Hofprediger ohne Herzog - angewendet werden konnten:
„9. Israel, du bringst dich in Unglück; denn dein Heil steht allein bei mir.
10. Wo ist dein König hin, der dir helfen möge in allen deinen Städten? und deine Richter, von denen du sagtest: Gib mir Könige und Fürsten?
11. Wohlan, ich gab dir einen König in meinem Zorn, und will ihn dir in meinem Grimm wegnehmen.“
Ob hier eine homiletische Geschicklichkeitsprüfung oder nur blanke Häme intendiert war, ist zunächst kaum zu entscheiden. Jedoch lässt sich der zweite aufgetragene (oder aber selbst gewählte?) Text (Jac 5, 7-8) nach dieser provokant wirkenden Vorgabe als eine Vermahnung zur Versöhnung an alle Beteiligten deuten - auch hier unter Einbeziehung des nachfolgenden 9. Verses als eines buchstäblichen Sub-Textes:
„9. Seufzet nicht widereinander, liebe Brüder, auf daß ihr nicht verdammt werdet. Siehe, der Richter ist vor der Tür.“
Der Eindruck dieser, am 5. Sonntag nach Trinitatis (3.7.1695) und am selben oder einem weiteren Tag abgelegten beiden Probepredigten, „wobey die meisten [warum nicht alle?] aus den vornehmen Geschlechtern, auch Gelehrten der Stadt zugegen waren“, war am Ende offenbar derart überzeugend, „daß so wol hohe als niedrige durch seinen Lehrreichen Mund geweydet zu werden wünscheten.“
Die Ordination Jauchs erfolgte schließlich am 8. Januar 1696 - und am 19. Mai desselben Jahres die Vermählung mit der gleichaltrigen Anna Margareta Meier (1669-1750), jüngste Tochter des ein Jahr zuvor gestorbenen Lambertipfarrers und „Senior Ministerii“ Georg Meier. Sie stellt damit wohl eher eine zeitübliche Versorgungsehe als eine Liebesheirat dar.
Bereits im Vorfeld hatte Jauch Unterstützung von unterschiedlichen Seiten erhalten:
„Geist- und Weltliche hatten demnach ein gutes Urtheil von ihm gefället, schrifft- und mündliche Zeugisse preiseten seine Orthodoxie und Aufführung aufs beste, einige gelehrte politici hatten aus seinen Discoursen eine besondere erudition bemercket“
Sellbst wenn man diese 1719 publizierte Eloge aus der Feder seines Ex-Kommilitonen (und von den genannten „politici“ finanzierten Biographen) Georg Bertram auf ihren wahrscheinlichen Wahrheitsgehalt reduziert.
Als vorerst letztes Beispiel für die ungute Atmosphäre unter den Beteiligten mag die Beobachtung dienen, dass in der am 30.11.1695 finalisierten, von sämtlichen Amtsbrüdern mit Unterschriften und Siegelabdrücken beglaubigten theologischen Unbedenklichkeitsbescheinigung, in der es heißt: „… sich der Gemeine zum Fürbilde guter Werke stellen werde“, das „werde“ gestrichen und durch „möge“ ersetzt wurde. Ob vor, während oder nach der Herumreichung des Zirkulars (von Haus zu Haus durch den Amtsdiener oder ad hoc innerhalb einer Kollegiumssitzung?) lässt sich ohne naturwissenschaftliche Analyse des Originals nicht beurteilen, welches farblich unterschiedlich wirkende, aber augenscheinlich gruppierbare Tinten- und Siegellack-Sorten aufweist.
Jauch amtierte als Prediger ab 1696 an der - 1861 wegen Bergsenkungsschäden abgetragenen, kurz zuvor noch photographierten, - spätgotischen Lamberti-Kirche mit ihrer einst (nach der von Michael Praetorius 1614 dokumentierten ursprünglichen Registerauflistung) größten Orgel ihrer Zeit, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts mit 43 Stimmen immer noch klangmächtigsten, von Georg Flor (und bis 1698 von dessen, in der „Möllerschen Handschrift“ vertretenen und als Komponist geistlicher Lieder aus der Feder Johann Rists bekannten Vater Christian Flor) bespielten Orgel Lüneburgs, als Johann Sebastian Bach im Frühjahr 1700 sein Auslandspraktikum in der wenige Minuten von Jauchs Predigtstätte entfernten Partikularschule nahe dem ehemaligen Michaeliskloster und in der auf dem Weg dorthin gelegenen Wohnung des Johannis-Organisten Georg Böhm (Neue Sülze Nr. 9) begann - dem Amtsnachfolger des älteren und Konkurrenten des jüngeren Flor. Reste dieser Orgel haben sich möglicherweise in der Katharinenkirche in D 21409 Embsen erhalten.
Dass Jauch eine oder mehrere Wiederaufführungen der 1667 für St. Lamberti entstandenen Matthäus-Passion Christian Flors (sen.) miterlebte oder zumindest deren Text und Musik einsehen konnte, ist als nicht unwahrscheinlich anzunehmen. Das seit dem 4. Februar 1945 im niederschlesischen Steinau (Ścinawa) verschollene Werk lässt sich dank der ausführlichen Beschreibung und auszugsweisen Spartierung der für Aufführungszwecke angefertigten, leider unvollständigen Stimmen-Abschrift durch Peter Epstein (BJ 1931) als ein früher Meilenstein der „Norddeutschen Territorialpassion“ (W. Braun) bewerten - wenngleich Epsteins durchaus bedenkenswerte Assoziationen zu BWV 244 heute nicht mehr als ganz so relevant betrachtet werden wie zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung.
Ähnliche Überlegungen könnten für die 1683ff datierten Passionen des Johannis-Kantors Friedrich Funcke angestellt werden. Dessen Matthäus-Passion integriert als Nr. 19 den Choral „O Lamm Gottes unschuldig“ als vom Alto gesungenen Cantus firmus zu einer Streicherbegleitung nach Art der ansonsten das Bild dieser Komposition prägenden Sinfoniae. Der Satz Nr. 22 verarbeitet charakteristische Auszüge des Chorals „Erbarm dich mein o Herre Gott“ an analoger struktureller Stelle wie die Arie „Erbarme dich“ in BWV 244b - und Nr. 31 in ähnlicher Manier „Christe du Lamm Gottes“.
Ob die am 18.3.1667(sic!; nicht 1664) abgeschlossene Tabulatur einer fast gleichartig (mit Chor, Gambenconsort, Continuo) besetzten Matthäus-Passion aus der Sammlung Düben der Universitätsbibliothek Uppsala tatsächlich (wie vom Herausgeber einer Neuausgabe vermutet; vgl. N.N. 2012) etwas mit Lüneburg, genauer: mit Flor sen. zu tun hat, bleibt vorerst rätselhaft.
Immerhin ist nicht auszuschließen, dass am selben Karfreitag 1667 in gleich zwei Lüneburger Kirchen (St. Lamberti und St. Johannis) zeitversetzt zwei etwa einstündige Passionsmusiken aufgeführt wurden, an denen jeweils bis zu vier Gambisten beteiligt waren - die aber naturgemäß nur von zwei verschiedenen Komponisten stammen konnten. Es sei denn, man betrachtet den Fall als spektakulären Auftakt Christian Flors in seiner Doppelfunktion als zeitweiliger Organist beider Kirchen - und damit die Stücke zwangsläufig als Organisten- statt als Kantoren-Musiken, was angesichts der überschaubaren, Orgelemporen-tauglichen Besetzung durchaus denkbar erscheint und wofür diskrete Spuren in späteren Ratsakten vorhanden zu sein scheinen.
Auf jeden Fall ergibt sich aus diesem Befund und seiner weiteren Betrachtung, dass Norddeutschland zwischen Hamburg, Rostock, Danzig und auch Lüneburg mehr denn je zu den frühesten Pflegestätten innovativer, protestantischer, bürgerlicher Passionsmusiken zu zählen ist.
Weiterhin ist auch zu bedenken, dass 1674 ein Exemplar der ein Jahr zuvor in Lübeck gedruckten (und damit auch für „bürgerliche“ Zwecke bestimmten) Matthäus-Passion des Gottorfer Hofkapellmeisters Johann Theile (Besetzung: u.a. 2 Bratschen, 2 Gamben) für die Notenbibliothek von St. Johannis angeschafft wurde. Und schließlich verzeichnet die virtuell rekonstruierte, dem jungen Bach real bekannte Chorbibliothek des Michaelis-Klosters, ein Exemplar der „Passio in Dialogo 2dum Matthaeum pro Clavicymbalo Organo &c. Mit 10 Stimmen gesetzt“ des Hamburger Kantors Thomas Selle aus dem Jahr 1642. (Vgl. Jekutsch 2000, Nr. 0772).
Die Tradition regelmäßiger Aufführungen vor oder während des Karfreitags reichte übrigens so lange, wie der Chorus Symphoniacus des Johanneums und der Mettenchor von St. Michaelis zur Verfügung standen - also bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts. (Vgl. Walter 1967.) Sie wurde 1855 mit einer ersten Aufführung von BWV 244 in St. Johannis wieder aufgenommen und wird bis heute fortgeführt.
1709 wechselte Jauch als 1. Prediger an die im „Wasserviertel“ gelegene, von musikalisch nicht besonders interessierten Patronatsherren regierte Nikolaikirche und 1714, bedingt durch seine allseits nicht nur zunächst, sondern dauerhaft widerwillig akzeptierte Ernennung zum Superintendenten, nach St. Johannis.
Damit wurde er auch zum „Inspector“ jenes Johanneums ernannt, dessen Chorus Symphoniacus während der beiden Kirchenjahre (1. Advent 1720 bis 1. Advent 1722) für die Aufführung von Vertonungen zweier, zusammen im Druck veröffentlichter Jahrgänge von Texten zur Musik zuständig war, die auf Vorlagen Erdmann Neumeisters und weiterer, noch zu identifizierender Autoren beruhten.
Aufgeführt wurden nach beinahe konstantem, aber nicht komplettem evangelischen Kirchenkalender an den drei städtischen „Haupt“-Kirchen (Johannis, Lamberti, Nikolai - nicht aber an der weitgehend exempten Kirche des ehemaligen Michaelis-Klosters) - mit klarer Fokussierung auf die wesentlichen Sonn- und Feiertage in St. Johannis - ab 1. Advent 1721 auch Teile des ersten „Concerten-Jahrgangs“ von Georg Philipp Telemann, der 1716/17 in Frankfurt auf Texte E. Neumeisters begonnen worden war und ab 1725 anhand von Ergänzungen aus der Hand Simonis’, Telemanns selbst und anderer Dichter fortgeführt wurde.
Mehr als 40 dieser weitgehend anhand textlicher RISM-Konkordanzen dokumentierbaren Kompositionen erklangen unter Leitung des - als finanziellem Profiteur fungierenden, als Prügelpädagoge unrühmlich aktenkundig gewordenen, als Komponist laut zeitgenössischen Urteilen nur mäßig erfolgreichen - Kantors Bernhard Christian Bohmsen in jenen Gottesdiensten in St. Johannis, in denen Jauch um 14 Uhr die (nach)mittägliche Hauptpredigt hielt und Georg Böhm die Orgel spielte.
Die Reihe endete - textlich und musikalisch bemerkenswert bescheiden - am 25. Sonntag nach Trinitatis 1722. Was darauf folgte, ist nicht bekannt.
Unter den ungenannten, laut Vorwort in Lüneburg zu suchenden Autoren (vielleicht auch Autorinnen?) einer Textsammlung für einen bereits 1713/14 vom Lamberti-Organisten Georg Flor (jun.) veranstalteten Kantatenjahrgang ist - neben dem bislang als ambivalent agierend beschriebenen Kantor (1694-1704) und späteren Stadtschreiber Heinrich Büttner und dem ambitioniert wirkenden, letztlich aber erfolglosen Dichter-Talent Joachim Christian Heini (1682-1738) - auch Johann Christoph Jauch zu vermuten.
Weiterhin sind Einzeltextdrucke von Trauerkantaten für die Beisetzungen und Hochzeitskantaten Lüneburger und benachbarter Honoratioren überliefert, die jeweils in ähnlicher Konstellation (aber wohl als reine Organistenmusiken ohne produktive Beteiligung des Kantors) realisiert wurden - wobei Böhm in diesen Fällen (zu denen auch Jauchs Beisetzung am 6.2.1725 zu zählen ist) das vom Rat in einem Verwaltungsgerichtsverfahren auf St. Johannis beschränkte, aber dem Grunde nach bestätigte Privileg zur kostenpflichtigen Erstellung der Kompositionen besaß.
Die Beförderung auf eine (de jure hoch aestimierte, de facto angreifbare) theologische Führungsposition innerhalb einer hierarchisch organisierten Stadtgesellschaft, die unter Berufung auf Sparbemühungen ohne überregionale Ausschreibung erfolgte (ganz anders als kaum ein Jahr später in Hamburg), und die mit einem nur geringen Einkommenszuwachs verbunden war, wurde gleichwohl von einem höher rangierenden Amtsbruder auf ausführlich dokumentierte, erschreckend intrigenhafte Weise bekämpft.
Sie erfolgte gegen den wiederholt, „unter Thränen“ erklärten Willen Jauchs, der sich bald darauf, am 17. April 1714, in einem sehr persönlich gehaltenen Brief (nach Inhalt und Diktion durchaus vergleichbar mit Bachs Schreiben an seinen Thüringer / Lüneburger Jugendfreund Georg Erdmann) an seinen ehemaligen Kommilitonen, den seinerzeitigen Jenaer Universitätsorganisten, nunmehrigen Universitätsrektor und späteren Bach-Bewunderer (vgl. DOK II, 369) Johann Jakob Syrbius, zu den näheren Umständen seiner Ernennung äußerte.
Diese wurden überlagert von langjährigen Präzedenzstreitigkeiten zwischen Patriziat und Geistlichem Ministerium (es ging - zumindest vordergründig - tatsächlich um die Rangfolge bei öffentlichen Auftritten), als dessen penibel, wegen der erwähnten Anfeindungen fast ängstlich agierender theologischer Geschäftsführer Jauch dann ab 1715 ein Jahrzehnt lang fungieren sollte. (Vgl. Wiesenfeldt 2016.)
Das jährliche Gehalt Jauchs setzte sich laut Anstellungsvertrag zuammen aus einem Fixum von 500 Rthlr. sowie aus amtsüblichen Naturalleistungen im Wert von 32 plus 16 Rthlr. (Für seinen Nachfolger werden per anno 1735 pauschal 800 Rthlr. genannt; vgl. Meyer 1941.) Bzgl. des Lebensstandards dürfte Jauch damit in etwa mit J.S. Bachs Leipziger Verhältnissen vergleichbar sein - immer unter Beachtung der örtlichen Lebenshaltungskosten und familiärer Verpflichtungen. (vgl. Wolff 2000; Heber 2017).
An Akzidenzien gebührten Jauch zwar keine Einnahmen aus Taufen, wohl aber ein Teil der in St. Johannis proclamierten Copulationen und die Zahlungen für Leichenbegängnisse und Beichten.
Letztere waren in Lüneburg nach dem Prinzip der Personalgemeinden - also Pfarrgrenzen-übergreifend - organisiert. Die Entlassung des „Häretikers“ Petersen 1692 war übrigens durch dessen Absicht ausgelöst worden, den obligatorischen Beichtpfennig abzuschaffen, und der Reformtheologe Heinrich Müller hatte zu seiner Zeit in Rostock diese Einkunftsart zwar nicht eliminiert, deren Erträge aber unter den Armen verteilt.
Bei wem der junge J.S. Bach während seiner Lüneburger Zeit beichtete, und ob (und ggf. wann und wo und von wem) der 15jährige konfirmiert wurde, ist bislang nicht einmal ansatzweise Gegenstand von Überlegungen. Für einen „Waisenknaben“ ohne jeglichen elterlichen Anhang und mit Migrationshintergrund käme für diese Funktion wohl nur ein nachgeordneter Geistlicher in Betracht, etwa der 2. Prediger an St. Michaelis, Johann Jacob Boie.
Dass Georg Böhm samt Familie und Gesinde sich Jauch (eventuell schon bei seiner Ankunft in Lüneburg?) als Beichtvater erwählt hat, ist zwar mangels Confitentenregistern nicht sicher belegbar, erscheint aber durchaus als möglich.
Bei seinem Dienstantritt 1698 fand Böhm ansonsten an St. Johannis Lüder Westing (amt. 1696-1719), Friedrich Heinrich Oldecop (1697-1708) und Heinrich Jonathan Wehrenberg (1698-1713) vor. Sollte er seinerzeit auf einen von ihnen vertraut haben, müsste er nach deren Tod zu Figuren wie Benedikt Benjamin Mirus (1720-1722) oder Johann Georg Fiken (1723-1740) oder Heinrich Clemens Dithmers (1709-1722) gewechselt sein. Oder eben (1715 bzw. 1723) zu Johann Christoph Jauch.
Das Ernennungsverfahren führte dazu, dass Jauch sich vor dem „Churfürstl. Consistorium, wovor ich meine praestanda bey einem Colloquio, auch eine lateinische Oration de materia gradam Theologica, auch Prob-Predigt in Hannover habe abglegen müßen“ erneut qualifizieren musste. Entsprechend fiel sein Klagegesang gegenüber Syrbius aus, und auch sein Biograph Bertram bedachte den Casus mit deutlichen, (von wirklich sämtlichen seiner Auftraggeber gebilligten?) Worten.
Die Begründung für die letztendliche Akzeptanz seines neuen Amtes gegenüber Syrbius zeugt davon, dass Jauch die Entscheidung in die Hände einer höheren Instanz zu legen versucht hatte - und dies auch gegenüber einer breiteren Öffentlichkeit thematisierte:
„Allein dessen allen ungeacht habe ich das was Gott auff meine Schultern legen wollen, theils ein beschwerliche Amts theils eine beharrliche Verfolgungslast müßen machen, und habe mit Jeremia bey meinem Antritt sagen können, Herr du hast mich überredet und ich habe mich überreden laßen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen.“
Jer 20,7 ist als offenkundiger Text der Antrittspredigt eine durchaus gewagte Wahl - besonders wenn man auch hier die nachfolgenden Verse 10 bis 12 mitliest, deren Anspielungen bei wörtlicher Interpretation nichts an Deutlichkeit vermissen lassen:
10 Denn ich höre, wie mich viele schelten und schrecken um und um. „Hui, verklagt ihn! Wir wollen ihn verklagen!“ sprechen alle meine Freunde und Gesellen, „ob wir ihn übervorteilen und ihm beikommen mögen und uns an ihm rächen.“
11 Aber der HERR ist bei mir wie ein starker Held; darum werden meine Verfolger fallen und nicht obsiegen, sondern sollen zu Schanden werden, darum daß sie so töricht handeln; ewig wird die Schande sein, deren man nicht vergessen wird.
12 Und nun, HERR Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz siehst, laß mich deine Rache an ihnen sehen; denn ich habe dir meine Sache befohlen.
Fast scheint es so, als ließe sich der Text von BWV 139 (zum 12.11.1724) als späte Reminiszenz an jene „beharrliche Verfolgungslast“ auffassen, unter der Jauch lange Jahre gelitten haben muss:
Gott ist mein Freund, was hilft das Toben,
so wider mich ein Feind erhoben!
Ich bin getrost bei Neid und Haß.
Ja, redet nur die Wahrheit spärlich,
seid immer falsch, was tut mir das?
Ihr Spötter seid mir ungefährlich.
Und BWV 126 (4.2.1725) - vordergründig gemünzt auf Luthers (heute zuweilen als despektierlich emfpundenen) Invektiven gegen „des Papsts und Türken Mord“ - erinnert zumindest unterschwellig an die falschen Amtsbrüder, als diese sich übergangen fühlten und darob (so Jauch gegenüber Syrbius 1714) „gar böse geworden“ waren:
Du weißt, daß die verfolgte Gottesstadt
den ärgsten Feind nur in sich selber hat
durch die Gefährlichkeit der falschen Brüder
Bemerkenswert an diesem speziellen Charakteristikum in Jauchs Biographie ist übrigens der Umstand, dass es J.S. Bach laut seinen eigenen Worten im Brief an Georg Erdmann 1730 in dieser Hinsicht in Leipzig aufgrund einer „wunderlichen und der Music wenig ergebenen Obrigkeit“ ganz ähnlich erging, denn er schreibt: „…mithin fast in stetem Verdruß, Neid und Verfolgung leben muß.“
Randbemerkung; Jauchs möglicherweise wichtige Rolle bei der Planung und Genehmigung der optisch und musikalisch wirkmächtigen Erweiterung der großen Orgel in St. Johannis durch den Orgelbauer Mathias Dropa (1712-1715) bleibt zu untersuchen, vllt. auch im Verlauf der jüngst für 2,2 Millionen Euro beauftragten Restaurierung dieses exzeptionellen Instruments und der zugehörigen Quellen-Dokumentation.
Ein Wechsel an die Marktkirche St. Georg in Hannover (die „dortige Haupt Kirchen“ des Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg - und somit eine „sehr avantageuse Verbeßerung“ - so Jauch in einer Eingabe von 1709) gelangte 1705 nicht zum Erfolg, da er - motiviert durch eine „aus hochgeneigter affection ohne mein Ansuchen“ gewährte Gehaltszulage seiner Patronatsherren von immerhin 100 Rthlr. p.a. - noch vor dem Ende des Verfahrens abgesagt hatte, obwohl er sich in Hannover hinsichtlich seiner Einkünfte „wohl dreyfach“ hätte verbessern können.
Als einer von 30, durch das örtliche Leitungsgremium vorgeschlagenen und von einer reisenden Berufungskommission (deren Spesenrechnungen mit der Hoffnung auf Hinweise zu weiterführenden Personalbeziehungen noch auszuwerten wären) beim Predigen evaluierten Kandidaten (unter diesen auch Bachs ehemaliger Mühlhäuser Vorgesetzter und Taufpate der erstgeborenen Tochter Catharina Dorothea, der Konsistorialrat Georg Eilmar), unterlag er Anfang 1715 denkbar knapp im fünften Wahlgang dem einflussreichsten Propagator und Produzenten moderner protestantischer Kantatentextformen - Erdmann Neumeister - bei der Wahl zum Hauptpastor der Hamburger Hauptkirche St. Jakobi.
Bereits 1707 hatte Jauch eine Anstellung als „Capellan“ dortselbst vorzeitig abgesagt, obgleich er als einer der acht (von zunächst 22) verbliebenen Bewerber durchaus Chancen gehabt hätte.
Vorgänger in jenem Amt war der durch seine literarischen Werke bekannt gewordene Johannes Riemer, und bereits der wortgewaltige Satiriker Johann Balthasar Schupp passt bestens in diese Tradition. Es scheint, als legte man an St. Jakobi immer wieder Wert auf sprachschöpferische Ambitionen der Hauptprediger. (Vgl. auch die einschlägige Literatur über den „Ersten Hamburgischen Theaterstreit“.) Die Wahl fiel - dies sei am Rande bemerkt - auf den promovierten Sprachwissenschaftler und Dichter Neumeister, der den Wechsel seines Metiers mit der rhetorischen Frage problematisierte: „Ob ein Poete wohl Superintendens seyn könne?“ (Vgl. Merzbacher 2000).
Dass der sprachlich nicht nur in Mitteldeutschland sozialisierte Neumeister (später mit feiner Ironie - nämlich in schönstem niederdeutschen Genitiv - formulierend: „Geld ist der Hamburger ihr Gott!“) seine neue, politisch und kulturell ungleich anspruchsvollere Gemeinde unter Hinweis auf die erwartete Niederkunft seiner Frau monatelang auf die Übersiedlung aus dem damals brandenburgischen Sorau (heute: Żary) warten ließ, wäre bei einer erfolgreichen Wahl Jauchs nicht nur wegen der geographischen Nähe, sondern auch wegen dessen völlig anders gearteter Persönlichkeitsstruktur kaum denkbar gewesen. Wohl in Erwartung einer langen, erfolgreichen Wirkungszeit (die dann tatsächlich eintreten sollte) „renovirten“ die Kirchgeschworenen 1715 die Kanzel in St. Jakobi - unter Anbringung einer vom Kirchenvolk bis heute zu bewundernden Gedenkinschrift.
Ähnliche Aufstiegsambitionen sind übrigens auch für Jauchs vier Jahre jüngeren ehemaligen Rostocker Kommilitonen Georg Raphel belegt, den geschätzten Kollegen und Nachfolger (1714 als Nikolai-Prediger, 1725 als Superintendent). Seit 1702 als Konrektor am Johanneum tätig, lehnte Raphel 1721 eine Wahl an den Hamburger Dom und 1727 eine Berufung an die dortige Hauptkirche St. Petri ab - im ersten Fall bedingt durch Kompetenzstreitigkeiten unter den Patronatsherren.
Man vergleiche auch G.P. Telemanns Bleibeverhandlungen bei dem letztendlich zugunsten J.S. Bachs entschiedenen Wechsel vom frisch ernannten Hamburgischen zum hoch erwünschten Leipziger Musikdirektor 1722/23 - eine Position, die sein Patensohn Carl Philipp Emanuel Bach erst Jahrzehnte später übernehmen und erfolgreich bekleiden sollte.
Ausführlichste und - trotz chronologischer Unschärfen - weitgehend zuverlässige Quelle für Jauchs Lebensumstände ist - zu ergänzen durch Analysen von Personalakten und autographen Briefen an norddeutsche, thüringische und kursächsische Gelehrte sowie an Leipziger Verleger - die aus erster Hand schöpfende Schilderung: „Das evangelische Lüneburg“ eines Jenaischen Kommilitonen - des 1728 in Braunschweig gestorbenen Pfarrers Georg Bertram, die dieser 1719 - etliche Jahre nach Abschluß des Manuskripts - „seiner geliebtesten Vater-Stadt“ Lüneburg widmete, und die leider nicht mehr die Zeit bis 1725 und die außergewöhnlichen Umstände von Jauchs plötzlichem Tod umfasst.
Bertram hatte bis 1687 (also im Alter von 14 bis 17 Jahren) „… auf speciale Gnade des Durchl. Landes-Herrn, Herrn Hertzogs Georg Wilhelms, in dem berühmten S. Michaelis Closter auf drey Jahre einen freyen Tisch bekommen, und war der information der damaligen Schul-Collegen überlassen worden.“ Das deutet zunächst einmal darauf hin, dass eine derartige Gratifikation (nicht zwangläufig zu verwechseln mit einer Mitgliedschaft im Mettenchor dieser Institution) für einen nichtadeligen, bürgerlichen, bildungsbeflissenen Gast allerhöchster Protektion bedurfte - besonders, wenn die reguläre Stipendienzeit von zwei Jahren überschritten werden sollte. (Vgl. Maul/Wollny 2011)
Bei der Diskussion von Bachs konkreten Lebensumständen wäre in diesem Zusammenhang - penibler als von der bisherigen Forschung - zu differenzieren nach monetären Einkunftsarten (regulierter Chorgesang im Gottesdienst in St. Michaelis und auf den - nicht immer konfliktfrei organisierten - Altstadtgassen; private, evtl. auch unter der Hand honorierte - auch musikpädagogische- Gefälligkeiten für Insassen der Ritterakademie), nach Kost (frei flottierendes Freitisch-Prinzip, finanziert aus halbamtlichen Umlagen), Logis (dauerhafte Unterbringung im heruntergewirtschafteten ehem. Klostergebäude oder aber wechselnde Schlafstätten bei Privatleuten gegen pädagogische Betreuung von deren Heranwachsenden) und nach der kostenfreien Teilnahme am Untericht - sicherlich eher in der baulich um 1700 noch halbwegs intakten, bürgerlichen Partikularschule als an der wenige Schritte entfernten Akademie, die den Zwangsmitgliedern des ständisch streng organisierten (inkl. paramilitärischer Schuluniformen) Lüneburgischen Landadels und einigen von höchster Stelle protegierten Gratifikanten vorbehalten war.
Was Georg Böhm andererseits vom jungen Bach als Gegenleistungen für die Bereitstellung von Kopiervorlagen für Tastenmusiken erwarten konnte, bleibt der Vorstellungskraft des Betrachters überlassen. Zu denken wäre an gelegentliche Mitwirkung als Aushilfe - zunächst als Vokalist, nach dem Stimmbruch überwiegend als Instrumentalist - z.B. auch bei Kasualgottesdiensten in St. Johannis (außerhalb der Schulstunden und der Gottesdienste an St. Michaelis).
Angesichts der nachgewiesenen beruflichen Differenzen zwischen Böhm und Georg Flor jun. (vgl. Walter 1967) bleibt zu vermuten, dass die durch Bach überlieferten Kopien von Werken Christian Flors sen. und anderer Komponisten in der „Möllerschen Handschrift“ wohl eher auf Vorlagen aus zweiter Hand zurückgehen - nämlich auf allfällige Bestände Böhms. (Vgl. Maul/Wollny 2011; die dort unreflektiert verwendeten Begriffe wie „Reisepass“ „Hochschulreife“; aber auch „Mettenschüler“, „Stadtorganist“ bedürfen grundlegenderer Betrachtungen.)
Bertrams enge persönliche Beziehung zur Familie Jauch spiegelt sich auch im Leichengedicht des Sohnes Ludolph Friedrich aus dem Jahr 1728 wider:
Du warst es, den mein Vater schon
Seit vielen Jahren liebt’ und ehrte,
Und den Er mich, als seinen Sohn,
Zu ehren und zu lieben lehrte.
Ihr zeigtet euch in Leid und Schmertz
Ein immer treugesinntes Hertz;
Gleichwie es jeden von euch rührte,
Wenn er des andern Wolseyn spürte:
So daß ihr von der ächten Art
Ein paar getreuer Freunde war’t.
Unklar sind die weiteren Beziehungen zwischen den Familien. So heiratete Ludolph Friedrich am 7.6.1746 Sophie Justine (geb. 1717), die Tochter eines Kauf- und Handelsmanns in Lüneburg. Diese hinterließ bei ihrem Tod 1779 ein Testament, das sich im Stadtarchiv erhalten, für die vorliegende Untersuchung aber als unergiebig erwiesen hat. (Vgl. Reuter 1918).
Es scheint, als habe Georg Bertram bereits vor 1719 (freilich in allgemeinerem Zusammenhang) die für die heutige Forschung betrüblichste Konsequenz aus dem plötzlichen, im Folgenden zu schildernden Tod Jauchs vorausgeahnt - nämlich die Unmöglichkeit, dessen Kantatentexte von 1724/25 nach Art eines J.C. Birkmann gesammelt zu publizieren: „… weil man wol weiß / wenn die Herren Autores davon sterben / daß es doch mit Editirung dergleichen operum postumorum die rechte Art nicht hat.“ (Zur Typologie der Publikationsformen vgl. Hobohm in BJ 1997).
Johann Christoph Jauchs Todesumstände müssen derart dramatisch gewesen sein, dass man im Januar 1725 seinen zwanzigjährigen Sohn Tobias Christoph brieflich („…bald die Post…“) zurück in die Heimat beorderte. Der nachmalige Lüneburger Notar war am 14. November des Vorjahres in der Lindenstadt Leipzig, wo er dem zwei Wochen danach eingeschriebenen, aus Nürnberg stammenden Erstsemester und späteren Bach-Librettisten Christoph Birkmann begegnet sein dürfte, und wo er bereits fünf Tage darauf bei der Uraufführung von BWV 26 erstmals eine von Bach komponierte Musik auf einen Text seines Vaters leibhaftig miterlebt haben konnte, und wohin er vielleicht eine neue Lieferung von Kantaten- und Passionstexten aus dessen Schreibstube überbrachte - sich zum Studium „der edlen Weisheits-Spur“ immatrikulierte. (Vgl. Erler 1909).
In Lüneburg traf Tobias Jauch seinen Vater dann bei der Ankunft am Ende von 300 Kilometern winterlicher Rückreise über der Erde stehend an (also noch vor der Beisetzung am 6. Februar 1725 ) und kollabierte psychisch und physisch, wie sich aus seiner - von wem auch immer in durchaus einfühlsam, durchaus geschickt dramatisierter Diktion zum Druck aufbereiteten - Schilderung ergibt. Zu vermuten bleibt, dass mit den „im Flore“ stehenden Künsten auch die Kirchenmusik gemeint war:
... Wenig Wochen sind es nur
Da ich zu den Linden-Höhen
Wo die Künst’ im Flore stehen
Zu der edlen Weisheits-Spur
Mit entflammetem Bemühn
Meinen ersten Weg genommen.
Ach da kriegt ich bald die Post:
Du sollst schon zurücke kommen.
Zweifel, Furcht und Bangigkeit
War es, was mein Hertz betroffen
Doch mich hielt ein schwaches Hoffen
Biß auff einmahl Ach und Leid
Über mich mit Hauffen kam
Denn ich musste zeitig wissen:
Es sey durch des Todes Hand
Mir mein Vater schon entrissen.
Sonsten fühlt man Freud und Lust
Wenn man seine Heimat siehet
Und ein Etwas, das uns ziehet
Regt mit Wallen Geist und Brust.
Ach bey mir wars umgekehrt.
Wie ich deine Thürme sahe
Du sonst werthe Vater-Stadt!
War mir Angst und Zagen nahe.
Doch diß war der Anfang nur
Da ich aber selbst erblickte
Was mich so zur Erden drückte
Da mir die betrübte Spur
Meiner vormals frohen Zeit
Meiner angenehmen Freuden
Plötzlich zu Gesichte kam
Da, da fand sich erst das Leiden.
Das gepresste Mutter-Hertz
Die benetzten Bruder-Wangen
Hauß und Licht mit Boy verhangen
Und zu letzt, o herber Schmertz!
Selbst des todten Vaters Sarg
Und die starrend blassen Glieder
Schlugen mich zur Erden hin
Und ich sanck in Ohnmacht nieder.
...
Sollte J.S. Bach von diesem gedruckten Text Kenntnis erlangt haben, wäre er mit Sicherheit an die Umstände erinnert worden, unter denen er bei der Rückkehr von seiner Dienstreise in das böhmische Karlovy Vary (Karlsbad) im Juli 1720 beim Betreten seiner Wohnung in Köthen von Tod und Begräbnis seiner ersten Ehefrau Maria Barbara erfahren musste.
Unterwegs muss Tobias Christoph Jauch demnach („denn ich musste zeitig wissen“) wohl aus der aktuellen Ausgabe des Holsteinischen Correspondenten vom 29./30. Januar 1725, die wenige Tage darauf (laut ungeschriebenem, aber rekonstruierbarem Plan am Dienstag, 6. Februar 1725 - auf jeden Fall während der Kompositionsphase von BWV 127) auch in Leipzig vorlag - vom Tod seines Vaters am „Stickfluß“ erfahren haben, also an einer - seinerzeit meist durch das Endstadium einer chronischen Tuberkulose beförderten - akuten Lungenerkrankung, die nach Beschreibungen zeitgenössischer medizinischer Autoren („Catharrus suffocativus“) nach spätestens drei Tagen zu einem qualvollen Erstickungstod führte.
„Nieder-Elbe, den 29. Jan. [1725]. Aus Lüneburg vernimmt man, daß am 19ten dieses der daselbst sehr beliebte Superintendent Hr. Jauch, an einem Stich-Flusse, plötzlich verstorben.“
Ein Blick in ein medizinisches Lexikon der damaligen Zeit eröffnet wenig Hoffnung für Betroffene:
„DEr Steck-Fluß ist ein plötzlicher Zufall / der die Patienten öfters in 12. biß 24. Stunden hinrichten kan / und ihn gar selten über den 3ten Tag leben lässet; Solches aber pfleget nicht sowol hagern / als corpulenten und voll-leibigen Personen zu begegnen / welche starcke / voll-blutige / und in ihren jüngern Jahren an Blut-Flüsse / oder auch ans Schröpffen und Aderlassen gewehnte Personen / in ihrem Alter / und gemeinlich beym trüben Wetter / überfället. Vorher gehet meistentheils Engbrüstigkeit und Husten vor / womit sodann verbunden ist ein heftiger zufluß seroser Feuchtigkeit: darauf pfleget sich Schwindel und Müdigkeit einzustellen / biß sie endliche schleunig erkalten / und auf der Brust ganz voll werden / und mit der grösten Gewalt nur noch ein wenig / und darzu mit starckem Recheln / athmen können; hierauf verlieren sich die Kräffte / dabey man befürchten muß / daß der Patient ersticken werde.“ (Vgl. Deigendesch 1719; Spickereit 2011. )
(Die zeitgenössischen Therapievorschläge seien an dieser Stelle aus vermutlich verstehbaren Gründen ignoriert, zumal der Verfasser dieser Zeilen am 6.12.2021 in den Genuss einer lebensrettenden, hoch-riskanten operativen Heilung einer ähnlich lebensbedrohenden Herz/Lungen-Erkrankung kam.)
Zufälligerweise notifiziert der „Correspondent“ nur wenige Tage später (10.2.1725) auch den Tod jener Person, über die bislang als den mutmaßlichen Urheber der Choralkantatentexte diskutiert wird (vgl. Schulze 1999):
„Leipzig, den 2. Februar. Ehegestern [31. Januar 1725] hat alhier Hr. Mag. Andreas Stübel, Con-Rector der Schulen zu St. Thomas, dieses Zeitliche gesegnet, und wird derselbe morgen beygesetzet werden. Weil er einige Zeit von seinen Schul-Laboribus als Emeritus oder befreyet gelebet, so hat er seine Zeit und Mühe auf Edirung des Fabrici oder Buchneri Lexici, so er etliche mahl ausgearbeitet, wie auch auf andere Sachen angewendet, da indessen ein anderer seine gewöhnlichen Schul-Labores diese Jahre über verrichtet gehabt.“
Stübels Teilhabe am Leipziger gottesdienstlichen Leben scheint bis in seine letzten Tage immerhin passiver Natur gewesen zu sein. Formal zwar ein Baccalaureus Theologiae, hatte er aber nie ein Predigtamt inne, wie der örtliche Chronist Chistoph Ernst Sicul kolportiert:
„Endlich wandelte ihm den 28. Jan. dieses 1725 Jahres unterm Gottesdienst in der Pauliner-Kirche ein Fieber an, welches ihn, seines Alters 71 Jahr 6 Wochen und 4 Tage, von der Welt genommen.“
Neben dem lebenslänglichen Ausschluss von öffentlichen Ämtern könnte diese Feststellung zugleich ein finales Argument gegen die vermutete Urheberschaft Stübels für die Texte des Choralkantatenjahrgangs darstellen: Warum hat er an jenem Sonntag, dem 28. Januar 1725, nicht die Uraufführung „seiner“ Kantate BWV 92 („Ich hab in Gottes Herz und Sinn“) in der Thomaskirche besucht, sondern dem Gottesdienst in der Universitätskirche St. Pauli beigewohnt? Es sei denn, Siculs Bemerkung bezieht sich auf die dort seit 1712 üblich gewordene nachmittägliche Vesper - in welcher aber nie eine reguläre Bachsche Sonntagskantate erklang. (Vgl. Stiller 1970)
Die zeitliche Differenz zwischen Spitzmarken und Erscheinungsdaten belegt auch an diesen Beispielen, dass derartige gedruckte Meldungen nicht mehr als sechs bis acht Tage für die Übermittlung zwischen Leipzig und Hamburg benötigten - und somit maximal fünf bis sieben Tage zwischen Leipzig und Lüneburg. (Vgl. Siegele 1983)
Von den drei Datumsangaben (19., 21., 26. Januar 1725), die für Johann Christoph Jauchs Todestag genannt werden, kann naturgemäß nur eine korrekt sein. Zwar verhindert das Nichtvorhandensein der diesen Zeitraum betreffenden Begräbnisregister von St. Johannis eine endgültige Klärung. (Die Sterberegister von St. Michaelis sind ab 1728 erhalten, die der übrigen Kirchen erst nach 1755; vgl. Buettner 1957).
Aber:
Der im Deutschen Geschlechterbuch (200/1996; 209/1999) sowie (bis zu einer vom Verfasser unter dem Pseudonym „Stubelius“ zum 2.10.2021 veranlassten Korrektur) im darauf fußenden Wikipedia-Artikel genannte 26. Januar scheidet aus, da bereits für den 24. Januar in Jauchs Personalakte eine Eingabe des Ministeriums-Seniors Friedrich Georg Koltemann wegen dringlicher Regelung zusätzlicher Predigtdienste überliefert ist, die durch den „unverhofften Todt“ des Superintendenten notwendig geworden waren, der „Denselben aus der Streitenden in die Triumphirende Kirche“ versetzte. Dieses Zitat nach dem spätmittelalterlichen Zisterzienser Alanus ab Insulis („Ecclesia militans“ / „Ecclesia triumphans“) war wohl ein letzter, (mit etwas Wohlwollen misszuverstehender oder als blanker Sarkasmus an die Adressaten gemünzter?) Nachklapp zu den jahrzehntelangen Kontroversen um die Position Jauchs.
Der zugehörige zeitgenössische Aktendeckel teilt übrigens nur mit (vgl. Reinhardt 1980):
„obiit d: [Leerstelle] Jan. 1725“
Der vom „Correspondenten“ genannte 19. Januar ist deshalb weniger wahrscheinlich, weil bis zum Erscheinungsdatum (29./30.) mit 10 Tagen ungewöhnlich viel Zeit für die Kommunikation zwischen Lüneburg und dem statt (Hamburg-)Schiffbek üblicherweise fingierten Erscheinungort „Nieder-Elbe“ vergangen wäre. (Vgl. Zedler 24/367). Eventuell markiert dieser Tag den Beginn der Endphase der Erkrankung, was zu der oben zitierten pulmologischen Prognose („… gar selten über den 3ten Tag …“) passt.
Deshalb erscheint die Angabe des Landesamtmanns Wilhelm Linke (1874-1929) am vertrauenswürdigsten, der bei der Katalogisierung norddeutscher Personalschriften zunächst (1912) pauschal „1725“ angegeben hatte, dann aber (1931 posthum gedruckt) konkret den „21.I.1725“ nennen konnte - anhand des einzigen bislang nachgewiesenen Exemplars einer Leichenpredigt im ehemaligen Staatsarchiv Hannover (Signatur: St.A. 2° 26), das dort in der Nacht vom 9. zum 10. Oktober 1943 verbrannte.
Demnach ist Johann Christoph Jauch an jenem dritten und letzten Sonntag nach Epiphanias 1725 in Lüneburg gestorben, an dem Johann Sebastian Bach 300 Kilometer entfernt in der Leipziger Nikolaikirche zur Predigt des Superintendenten Salomon Deyling die Choralkantate „Was mein Gott will das gscheh allzeit“ (BWV 111) uraufführte, in deren spätestens zwei Wochen zuvor übermitteltem Text es heißt:
So geh ich mit beherzten Schritten,
auch wenn mich Gott zum Grabe führt.
Gott hat die Tage aufgeschrieben,
so wird, wenn seine Hand mich rührt,
des Todes Bitterkeit vertrieben.
Drum wenn der Tod zuletzt den Geist
noch mit Gewalt aus seinem Körper reißt,
so nimm ihn, Gott, in treue Vaterhände;
wenn Teufel, Tod und Sünde mich bekriegt
und meine Sterbekissen
ein Kampfplatz werden müssen,
so hilf, damit in dir mein Glaube siegt.
O seliges, gewünschtes Ende!
Es ist nicht genau bekannt, in welchem gesundheitlichen Zustand sich Johann Christoph Jauch an seinem letzten Lebenstag befand. Auch wenn er nicht ganz bis zum Ende bei klarem Verstand gewesen sein sollte, so starb er doch vielleicht in dem Bewußtsein, dass sein Text - ein seltenes, aber nicht singuläres Beispiel für eine Bibel-Auslegung „ad hominem“ - zu diesen Stunden in einer Vertonung eines Komponisten erklingen sollte, der über den Verlauf seiner Erkrankung informiert gewesen sein musste.
Ob dem von Bach vertonten Text „aus seinem Körper“ urspünglich „aus meinem Körper“ zugrunde lag, wie vier Zeilen später angedeutet: „meine Sterbekissen“, bleibt der Vorstellungskraft des Betrachters überlassen. Hingegen dürfte „… in dir mein Glaube …“ sich zwar sprachlich, gewiss aber nicht theologisch zu „… in mir dein Glaube …“ umformen lassen.
Individualeschatologische Ahnungen dieser Art finden sich bereits zwei Wochen zuvor, am 1. Sonntag nach Epiphanias (7.1.1725), in der Kantate BWV 124/3:
Und wenn der harte Todesschlag
die Sinnen schwächt, die Glieder rühret,
wenn der dem Fleisch verhaßte Tag
nur Furcht und Schrecken mit sich führet,
doch tröstet sich die Zuversicht:
ich lasse meinen Jesum nicht.
Die Tendenz zur Beschäftigung mit der eigenen Todesstunde läßt sich noch weiter zurück verfolgen, etwa zur Kantate BWV 8 (24.9.1724):
Was willst du dich, mein Geist, entsetzen,
wenn meine letzte Stunde schlägt?
Mein Leib neigt täglich sich zur Erden,
und da muß seine Ruhstatt werden,
wohin man so viel tausend trägt.
Und bereits im Auftaktwerk des Zyklus, in der Kantate BWV 20 (11.6.1724; vgl. Leisinger 2002), wird an die Unberechenbarkeit des Lebensendes gemahnt mit den Worten:
Vielleicht ist dies der letzte Tag,
kein Mensch weiß, wenn er sterben mag.
Wie leicht, wie bald
ist mancher tot und kalt!
Man kann noch diese Nacht
den Sarg vor deine Türe bringen.
Selbst in einer ansonsten vollständig durch die freudenreiche Feier von Christi Geburt bestimmten Kantate BWV 133 („Ich freue mich in dir“, zum III. Weihnachtstag 1724) bringt der Autor es fertig, Gedanken an das eigene Ende einzuflechten, indem er schreibt:
Wohlan des Todes Furcht und Schmerz
erwägt nicht mein getröstet Herz
Will er vom Himmel sich
bis zu der Erde lenken,
so wird er auch an mich
in meiner Gruft gedenken
[…]
.
Schon bald nach dem Beginn des Kantatenzyklus (BWV 135/4, 25.6.1724) bemüht der Autor eine Situationsbeschreibung, die - auf den ersten Blick in eindeutiger Übernahme aus Ps. 6;7 - auf seine individuelle psychische und physische Befindlichkeit hinweist. Müdigkeit und Nachtschweiß, die zunächst im Rezititativ Nr. 2 („Ach heile mich, du Arzt der Seelen; ich bin sehr krank und schwach;“) auf eine theologische Deutungsebene projiziert werden, gelten - lebensweltlich betrachtet - in der historischen wie in der heutigen Heilkunde als Leitsymptome einer chronischen Tuberkulose - einer Krankheit, die immer noch weltweit verbreitet ist.
Ich bin von Seufzen müde,
mein Geist hat weder Kraft noch Macht,
weil ich die ganze Nacht,
oft ohne Seelenruh und Friede,
in großen Schweiß und Tränen liege.
Ich gräme mich fast tot und bin vor Trauern alt;
denn meine Angst ist mannigfalt. (BWV 135/4)
Der Tagesanbruch als vorläufige Erlösung von nächtlichen Qualen wird im Terzett der Kantate BWV 38 (Aus tiefer Not schrei ich zu dir, zum 29.10.1724) thematisiert:
Wie bald erscheint des Trostes Morgen
auf diese Nacht der Not und Sorgen!
Ähnliche Andeutungen, die auf eine chronische Erschöpfung schließen lassen, finden sich auch in einer unabhängigen Quelle, nämlich im Text der am 6.2.1725 anlässlich der Beisetzung Johann Christoph Jauchs in St. Johannis aufgeführten Trauerkantate. Fast scheint es so, als habe deren (noch zu nennender) Verfasser die entsprechenden Zeilen von BWV 135 gekannt - zumindest aber die zugrunde liegenden Lebensverhältnisse des zu Betrauernden:
Inzwischen blieb doch dies dein Leben
Von mancher Last gedrückt, mit mancher Müh umgeben:
Daher uns das nicht Wunder nimmt,
Wenn deine fromme Seel’ oft klagend angestimmt,
Daß sie ermüdet, und dabey
Begierig nach der Ruhe sey.
Der unmittelbar anschließende Choral zitiert - durchaus passend - die zweite Strophe des Kirchenlieds „Du, o schönes Weltgebäude“, dessen fünfte Strophe „Komm, o Tod, du Schlafes Bruder“ in der Kreuzstabkantate BWV 56 (zum 27.10.1726) verwendet wird.
Müde, die der Arbeit Menge
Und der heisse Strahl beschwert,
Wünschen, das des Tages Länge
Werde durch die Nacht verzehrt;
Daß sie nach so vielen Lasten
Können sanft und süsse rasten;
Ich wünsch auch bey dir zu seyn,
Allerschönstes Jesulein!
Sowohl der Autor der Kreuzstabkantate - Christoph Birkmann, - neuerdings als ephemerer „Leipziger Librettist“ erkannt und somit einer der legitimen Nachfolger Johann Christoph Jauchs, - als auch der Autor der Lüneburger Trauerkantate ignorieren übrigens die teils deutlich abweichenden Fassungen, die im Wagnerschen Gesangbuch von 1697 zu finden sind, sondern zitieren die ursprünglichen Versionen aus Johann Crügers „Praxis Pietatis Melica“, die auch in den Lüneburger Stadt- bzw. Herzoglich Cellischen Landes-Gesangbüchern verwendet wurden.
Eine Suche nach tieferen Ursachen für Jauchs persönliche Probleme - oder zumindest nach seiner eigenen Reflexion darüber - führt schließlich sehr weit zurück, nämlich in den späten November des Jahres 1711. In seiner Eingabe wegen Fortführung einer 1705 gewährten Gehaltzulage schreibt der damals 43jährige Nikolai-Prediger - in Bezug auf seine überdurchschnittliche Belastung durch (wohl nicht im erhofften Umfang an theologische „Subunternehmer“ delegierbare) Predigtdienste - buchstäblich in Parenthese und den Tod mit letztendlich 55 Jahren vorausahnend:
„ … und meine so vielfältige Arbeit (wie ich ja fast wöchentlich dreimal nicht ohne Verkürzung meiner Leibes und Lebenskräfte doch herzlich gerne zu Gottes Ehre in meiner allseitigen geliebten Gemeine zum besten nach möglichstem Vermögen selbst verrichte) mich wohl viele Jahre eher als sonsten von den lieben Meinigen abreißen wird.“
Rechtfertigt diese Aussage die Annahme, dass J.C. Jauch mindestens anderthalb Jahrzehnte im ständigen Bewußtsein einer chronischen, auszehrenden Erkrankung (vulgo „Schwindsucht“) gelebt, gepredigt, gelitten und gedichtet hat?
Ist es eine mehr als zufällige Anspielung, wenn für die Choralkantate BWV 114 (zum 1.10.1724) der Autor das dreifache Kopulativkompositum „Sünden-Wasser-Sucht“ generiert, das ein - für schwere Lungenkrankheiten im Endstadium typisches - Symptom umschreibt, das hier freilich zu einer heute befremdlich wirkenden Illustration eines theologischen Sachverhalts erweitert wurde? (Vgl. Hiob 15,16; nach Vulgata bzw. nach Luther: „quanto magis abominabilis et inutilis homo qui bibit quasi aquas iniquitatem“ / „Wie viel weniger ein Mensch, der ein Greuel und schnöde ist, der Unrecht säuft wie Wasser…“).
Das Unrecht säufst du ja
wie Wasser in dich ein,
und diese Sünden-Wassersucht
ist zum Verderben da
und wird dir tödlich sein.
(BWV 114 )
Die Auseinandersetzung mit der Vorwegnahme der eigenen Sterbestunde kulminiert schließlich in der Kantate BWV 127 (zum 11.2.1725) - nach Meinung maßgeblicher Kommentatoren (wie bereits Smend 1966) nicht nur in kompositionstechnischer Hinsicht der Höhepunkt des Choralkantatenschaffens - in deren Musik und Text sich die existenzielle Befindlichkeit des Autors mit der Hoffnung auf eine Erfüllung dogmatisch begründeter Verheißungen verbindet - in Form von Konditionalsätzen, die sich bald nach ihrer Formulierung und kurz vor ihrer Vertonung bitter realisieren sollten:
Wenn alles sich zur letzten Zeit entsetzet
und wenn ein kalter Todesschweiß
die schon erstarrten Glieder netzet,
wenn meine Zunge nichts als nur durch Seufzer spricht
und dieses Herze bricht:
genung, daß da der Glaube weiß,
da Jesus bei mir steht,
der mit Geduld zu seinem Leiden geht
und diesen schweren Weg auch mich geleitet
und mir die Ruhe zubereitet.
Ferner gibt es einige Allusionen zu einer anonymen (I. A. = Incertus Auctor = ungewisser Autor) Paraphrase des Chorals „Herr Jesu Christ …“, die wenige Ordnungsnummern nach dem Original (Nr. 379) unter den Sterbeliedern des Lüneburgischen Landesgesangbuchs (Celle 1697, 1716) zu finden ist, wo es in Strophe 9 / 10 heißt:
Wan sich die zunge nicht mehr reg’t
Und meine sprach’ sich gänzlich leg’t /
So hör’ die seuffzer / die ich thu /
Und bring’ mich bald zu deiner ruh’/
Wan drauff in meiner angst an mir
Der todes-schweiß gar bricht herfür /
Auffällig sind Querbezüge zur dritten Strophe des Chorals „Meinen Jesum lass ich nicht“, der einen Monat zuvor (7.1.1725) Grundlage für die gleichartig-benamte Kantate BWV 124 bildete:
Lass vergehen das Gesicht,
Hören, Schmecken, Fühlen weichen,
lass das letzte Tageslicht
mich auf dieser Welt erreichen:
wenn der Lebensfaden bricht,
meinen Jesus lass ich nicht.
Das Motiv des Sehverlusts im Vorfeld der Sterbestunde findet drei Wochen später (zum 2.2.1725) eine weitere Entsprechung in BWV 125:
Ich will auch mit gebrochnen Augen
nach dir, mein treuer Heiland, sehn.
Wenngleich des Leibes Bau zerbricht,
doch fällt mein Herz und Hoffen nicht.
Mein Jesus sieht auf mich im Sterben
und lässet mir kein Leid geschehn.
Der unübersehbare Perspektivwechsel - Christus sieht auf den Sterbenden, der sich mit letzter Kraft um einen Blick auf den „treuen Heiland“ bemüht, welcher diese Art der Zuwendung ebenso treuevoll erwidert - ist ein weiteres Indiz für die untrüglich empfundene Hoffnung des Autors jener Zeilen auf ein Ende, das „kein Leid“ verursachen möge.
Ob J.S. Bach 1750 in seinen, von einer medizinisch zeitüblich brutal, schließlich mit letalem Ausgang traktierten Augenkrankheit geprägten, letzten Tagen, Wochen, Monaten ähnliche Erfahrungen durchleben musste?
Generell ergibt sich aus den vorgenannten Belegen die Frage, ob und in wieweit der Autor in diesen und in weiteren Fällen mit einer Art „doppeltem literarischen Boden“ operiert, indem er das „poetische Ich“ einen vordergründig rein theologisch fundierten Text verkünden lässt, aus dem sich - und sei es nur von ihm selbst - auf einer zweiten Ebene lebensweltliche Erlebnisse, Empfindungen und Erwartungen des „realen Ich“ herauslesen lassen?
Wäre ein Vergleich mit Heinrich Heines bitter-ironischem Hilferuf aus seiner Pariser „Matratzengruft“ 1851 eine allzu voreilige Vorweg-Annahme eines - für barocke, lutherische, geistliche Gebrauchslyrik noch nicht thematisierten, wegen forschungsideologischer Grundbedenken wohl auch kaum je mit Erfolg zu untersuchenden - literarischen Gestaltungsprinzips?
Jetzt bin ich müd vom Rennen und Laufen
Jetzt will ich mich im Grabe verschnaufen.
Lebt wohl! Dort oben, ihr christlichen Brüder
Ja, das versteht sich, dort seh`n wir uns wieder.
Das Thema „Subtexte“ in Bachs wortgebundenen Werken lohnt auf jeden Fall weitere Untersuchungen, auch über den Choralkantaten-Jahrgang hinaus (ganz besonders bzgl. BWV 211!)
Ist es mehr als ein Zufall, dass Johann Sebastian Bach am 20.1.1726 (2. Sonntag nach Epiphanias) an den ersten Jahrestag des Todes seines Librettisten gedenkt, indem er einen 1711 publiziertenText aus der Feder des Darmstädter Hofpoeten Georg Christian Lehms vertont (BWV 13), der - mit nur schwachem Stichwortbezug zur Perikope („Jammerkrug“; Joh 2,1-2) - über„Ächzen und erbärmlich Weinen“ als Mittel gegen „der Sorgen Krankheit … in der Trauerbrust“ reflektiert? Obwohl Lehms - angeblich - erst 1717 an den Folgen einer Lungentuberkulose sterben sollte, nimmt sich sein sechs Jahre zuvor veröffentlichter Text wie die Vorwegnahme einer konkreten Krankheitssituation aus, die der des Autors von BWV 135 und BWV 127 erstaunlich gleicht:
Mein Kummer nimmet zu
Und raubt mir alle Ruh,
mein Jammerkrug ist ganz mit Tränen angefüllet,
und diese Not wird nicht gestillet,
so mich ganz unempfindlich macht.
Der Sorgen Kummernacht drückt mein beklemmtes Herz darnieder,
drum sing ich lauter Jammerlieder.
Die sonst bei Lehms in zeittypischer Manier poetisch überhöhte Todessehnsucht findet hier eine Vorahnung, die ohne eigene Betroffenheit des Verfassers kaum erklärbar ist.
Dass andererseits Johann Christoph Jauch von Lehms inspiriert worden sein dürfte, belegt das Beispiel von dessen Text zum 16. Sonntag nach Trinitatis. Dieser korreliert mit BWV 111 in folgenden Allusionen: „Ach! daß sich nicht sofort mein Geist / Aus dem bedrängten Körper reißt“ und mit BWV 127: „So mögen drauff die Sterbe-Klocken klingen“.
Jauch ist, mit Ausnahme seiner - erfreulicherweise exzellent und fortlaufend digitaliserten, nicht nur aus sprachlichen Gründen heute aber kaum noch adäquat zu beurteilenden - Beteiligungen an lateinischen Disputationen, seiner zahlreichen, durchgängig auf gutem Deutsch verfassten gereimten Grußworte in Drucken befreundeter Rostocker Akademiker und seiner Beiträge in Lüneburger Personalschriften, auf den ersten Blick publizistisch kaum erkennbar hervorgetreten. Sein durch verschiedene Aussagen belegtes bescheidenes Wesen ist als Grund dafür anzusehen, dass er aus eigenem Antrieb wenig produziert hat, was heute noch rezipierenswert erscheint.
Für die Praxis der brieflichen Kommunikation Johann Christoph Jauchs, dessen Bruder Carl (1680-1755) als Lübeckischer Postmeister in Lüneburg amtierte, gibt es erfreulich sachdienliche Belege von seiner eigenen Hand.
Am 16. April 1716 entschuldigt er sich beim Hamburger Rektor Johann Albert Fabricius, dessen 20.000 Bände umfassende Privatbibliothek er bei einem Besuch bewundert hatte und den er drei Wochen zuvor mit einer Frage wegen Aufnahme seines Sohnes Tobias in dessen Haus- und Lehrgemeinschaft angeschrieben hatte, wegen seiner verspäteten Antwort auf dessen Reaktion:
„… so habe ümb so vielmehr ursache zu depreciren, daß ich meiner schuldigkeit nach nicht so gleich wieder geantwortet, doch werden die Ew. HochEhrwürden wol bekannten Labores Ministeriales, die mir absonderlich so wol in der Stillen Woche alß heiligen Osterfest obzulegen haben, einen Geistlichen leicht excusiren. So bald aber das liebe Fest zurück gelegt, habe ich nicht unterlaßen wollen, hiermit den verbindlichsten danck abzustaten …“.
Der Verweis auf die Amtspflichten in den Osterwochen erscheint bei näherer Betrachtung als vorgeschoben, da Jauch im weiteren Verlauf des Briefs umständlich gesteht, die Zeit genutzt zu haben, um im Kreise Hamburger Freunde eine alternative, deutlich kostengünstigere (nämlich kostenlose) Unterbringungsmöglichkeit für seinen Filius auszumachen. Weitere, scheinbar nebensächliche Bemerkungen Jauchs in diesem Briefwechsel ermöglichen Rückschlüsse auf dessen persönliche Befindlichkeiten während seiner eigenen Studienzeit ein Vierteljahrhundert zuvor.
Bei der Materialsammlung für eine allumfassend angelegte Dokumentation der Feiern zum Reformationsjubiläum 1717 durch den Gothaer Hofbibliothekar Ernst Salomon Cyprian war Jauch (als „Haupt“ des Lüneburger Ministeriums) eine briefliche Anfrage der Leipziger Verlagsbuchhandlung „Gleditsch et Weidemann“ durch seinen Nachbarn, den Drucker, Verleger und Buchführer Johann von Stern übermittelt worden, der sie von seinem routinemäßigen Besuch der Leipziger Ostermesse 1718 mitgebracht hatte.
Unter dem Datum des 20.4.1718 entschuldigt Jauch sich für die verspätete Beantwortung, die er u.a. mit einer vorangegangenen Reise begründet und die er ursprünglich bis zur nächsten Messe im Herbst aufschieben wollte - wohl in der Absicht, von Stern wiederum als Überbringer einzusetzen. Stattdessen wurde das Schreiben durch Ludolph Daniel Kraut, den Sohn des ihm unterstellten und zugleich freundschaftlich verbundenen Rektors Paul Kraut, nach Leipzig überbracht, wohin jener sich zum Theologiestudium begab - bevor er sich (am 10. Oktober 1720) zusammen mit Tobias Jauchs älterem Bruder Ludolph Friedrich an der Universität Helmstedt immatrikulierte. Tobias vollzog diesen Schritt übrigens erst am 6.10.1727. (Vgl. Erler 1909; Mundhenke 3/1979, 5186/87;6137)
Der Brief belegt zudem, dass die ungewöhnlich aufwändige, zunächst auf Latein exerzierte, dann wegen des großen Erfolgs in einer deutschen Übersetzung zweimal für das breite Publikum wiederholte, mit musikalischen Arien durchflochtene Dramatisierung wesentlicher Ereignisse der Reformation 1517 durch einen „Actus Oratorio Dramaticus“ im „Rectorat“ des Johanneums mit ca. 50 namentlich benannten Mitwirkenden (darunter Kraut junior in der Hauptrolle des Dr. Martinus Luther und Tobias Jauch als Rezitator) auf eine Initiative des Superintendenten in seiner Funktion als Schulinspektor zurückging. (Vgl. Cyprian 1719).
Das erwähnte Schreiben an J.J. Syrbius von 1714 war ebenfalls durch einen zwecks Immatrikulation (in diesem Fall nach Jena) reisenden Studenten überbracht worden, nämlich durch den aus Ratzeburg stammenden, von Jauch beherbergten und pädagogisch betreuten Georg Ludwig Neubaur (1693-1775). Aus der zeitlichen Differenz zwischen Briefdatierung und dem Eintrag in der Matrikel ergibt sich in diesem Fall eine ungefähre Reisezeit von 10 Tagen zwischen Lüneburg und Jena.
Am 3.11.1718 entschuldigt Jauch sich beim Dresdener Kreuzkirchen-Pfarrer und Superintendenten Valentin Ernst Löscher, dem er „per couvert“ (zum Begriff vgl. Zedler 6/1507) antwortet, wegen der verspäteten Rückmeldung auf dessen Anfrage nach Gelegenheiten für eine standesgemäße, aber nicht zu teure Unterbringung einer sächsischen Predigerwitwe in einem norddeutschen „Evangelisch-Lutherisch Closter“:
„Es ist mir dieser Tage von einem aus der Leipziger Meße [Michaelis-Messe] retournirenden Hamburgischen Kauffmann, ein von Ew. HochEhrw. Magnif. geschriebener Brieff insinuiret, der bereits am 4. Sept. datiret, und nescio quo fato so gar späte erst an mich geliefert. Ich erschreckte mich gewiß recht dabey, da der brieff schon so alt, und gedachte, es würde Ew. Magnif. ein übel concept faßen da ich ein solches geehrtes Schreiben so lange unbeantwortet bey mir liegen ließe. Allein ich kann hoch contestiren, daß ich denselben erwehnter maßen nur vor einigen tagen erhalten habe daher nicht ermangeln wollen, so fort gehorsamst darauff zu antworten.“
Als weiterer Kandidat für eine temporäre persönliche Beziehung zwischen Lüneburg und Leipzig mag der Jurist und spätere Inspektor der Ritterakademie, Johann Georg Wehrenberg (1702-1780), Sohn von Jauchs vertraulich verbundenem Vorgänger, genannt werden, der 1724 in Leipzig Mitglied des „Montäglichen Großen Predigerkollegs“ und der „Vertrauten Rednergesellschaft“ war. Freilich, ohne dass bislang konkrete briefliche Kontakte gefunden werden konnten. (Vgl. Döring/Menzel/Otto 2015.)
Wie schließlich in diesem Zusammenhang die Tatsache zu bewerten ist, dass C.F. Henrici unter dem Datum des 1.1.1725 ein Gedicht auf die Hochzeit des Sohnes von Jauchs Kollegen, Johann Georg Koltemann (1721-29 an St. Lamberti und St. Nikolai amtierend), verfasste, das er später in seine gedruckte Gedichtsammlung aufnahm, bleibt zu untersuchen.
Diese konkreten Beispiele belegen, dass die Kommunikation zwischen Nord- und Mitteldeutschland nicht nur auf die reguläre, reitende Reichspost und die immer wieder mühsam regulierten, fahrenden Nebenposten („Gelbe Kutsche“; „Braunschweiger Küchenpost“) angewiesen war, sondern - trotz aller Unwägbarkeiten - auch auf die persönliche Überbringung durch reisende Vertrauenspersonen setzen konnte - und dass Jauch durchaus Wert auf eine zeitnahe Beantwortung von Anfragen legte.
Dass J.S. Bach bei der Komposition der zweiten Text-Tranche seiner Choralkantaten zum 9., 16. und 23. Juli 1724 erhebliche systemische Irregularitäten in Kauf nehmen musste, ließe sich auch durch Komplikationen bei der Übermittlung der Manuskripte erklären und bedarf weiterer Untersuchungen. (Vgl. z.B. Scheide 2003.)
Generell ist Einiges zu beachten. J.S. Bach wird aus bester Quelle nachgesagt: „Bey seinen vielen Beschäftigungen hatte er kaum zu der nöthigsten Correspondenz Zeit, folglich weitläuftige schriftliche Unterhaltungen konnte er nicht abwarten“. (Vgl. Dok VII, B6) Andererseits beschäftigte er zeitweise in der Person seines Vetters Johann Elias Bach einen veritablen Privatsekretär, dessen Eifer die Überlieferung einiger der sehr seltenen nicht-amtlichen Schreiben des Komponisten zu verdanken ist.
Der - in mindestens zwei Exemplaren überlieferte - Text Jauchs für eine Kantate zur Hochzeit des ihm dienstlich und somit wohl auch persönlich verbundenen Lüneburger Lamberti-Organisten Georg Flor aus dem Jahr 1705 vermag vom Entwicklungsprozess seiner Dichtkunst zu zeugen - zu einem Zeitpunkt, als sich moderne deutschsprachige Kirchenmusiken nach dem Muster Erdmann Neumeisters noch kaum in der Anfangsphase ihrer praktischen Erprobung befanden.
Ein 2023 aufgetauchter weiterer (inhaltlich divergierender) Textdruck zu eben dieser Vermählung aus der Feder des Johannis-Kantors Heinrich Büttner, zur Vertonung bestimmt durch den Johannis-Organisten Georg Böhm, vermag zu erhellen:
Zum einen belegt das Gelegenheitswerk ein offenbar noch freundliches Verhältnis zwischen den Musikern und ihren pastoralen Dienstherren, die - zu einem späteren Zeitpunkt - in gerichtsnotorische Differenzen um ihre existentiellen Einkunftsarten geraten sollten.
Zum anderen zeigt es, dass die Kompositionen des Duos Jauch/Flor erheblich moderner gestaltet waren bei der Wahl textlicher und musikalischer Mittel. Sie verwendeten zwar ebenfalls Strophenarien, aber die Einbeziehung von Rezitativen und durchaus abwechslungsreichen, vokal-instrumentalen Besetzungen wirkt aus heutiger Sicht deutlich fortschrittlicher als die eher dem 17. Jahrhundert verpflichtete Kompositionsweise Böhms, welcher die sechs Verse des 128. Psalms sehr schematisch durchführt.
Dass auf dem Titelblatt einer 1705 gedruckten, musikalisch sehr ähnlich (mit älteren Concerto-Elementen, aber auch mit Rezitativen und instrumental begleiteten Chor- und Solo-Arien mit teils ausgeschriebenem, teils Couplet-artigem Proto-Da Capo) aufgebauten, ohne herkömmliche Verfasserangabe überlieferten Kantate zur Hochzeit des Hamburger Advocaten Barthold Walther mit der Lüneburger Kaufmannswitwe Ilsabe Dorothe Vollmann geb. Cruse der Name des Urhebers in Form eines Dedikationsspruchs abgebildet ist, dessen Anfangsbuchstaben ihn - samt Beruf und Wirkungsort - für damalige wie heutige Eingeweihte eindeutig identifizierbar machen, belegt als exponiertes Beispiel die lebenslange Vorliebe Jauchs für typographisch/bibliographische Vexierspiele.
Syntax und Wortwahl der folgend (mit geändertem Zeilenfall) entnommenen Wörter aus dem Titel des erwähnten Textdrucks legen die Vermutung nahe, dass im Kern eine intrikat verdeutschte lateinische Sentenz stecken könnte, deren Identifizierung vielleicht weitere Zuschreibungen ermöglicht. Der vorliegende deutsche Wortlaut lässt sich jedenfalls mit hinreichender Eindeutigkeit auflösen:
Einer der die Freundschafft
[M]it [J]hnen [C]ontinuirend
[J]ederzeit [Pr]omittiret [zu] [L]oben /
D[I]e [G]ütigste [F]ügung g[O]ttes.
lässt sich lesen als:
Entsprungen der dienstbereiten Feder
[M]agister [J]ohann [C]hristoph
[J]auchs, [Pr]ediger [zu] [L]üneburg
[I]ohann [G]eorg [F]lor [O]rganist.
Zu einem kaum widerlegbaren Beweis erhoben wird dieses Indiz für den Autorennachweis (neben der engen beruflichen Beziehung der Protagonisten) durch die Tatsache, dass das Titelblatt des Kantatendrucks mit einem leicht umformulierten Zitat des Psalms 73, 23-24 beginnt, welches als lebenslanges theologisches Motto Jauchs belegt ist - z.B. durch das bis heute verwendete Familienwappen, welches auf einen Abdruck seines Ringsiegels zurück geht:
„Die Leitung Gottes nach seinem Raht.“
Mit diesem alttesttamentlichen Dictum beginnt auch das „Concert. a 4. Voc. C.A.T.B.“, mit dem die Kantate anhebt, als deren Komponist in der o.g. obfuszierten Form der Lamberti-Organist Johann Georg Flor genannt wird.
„Herr, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältest mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinen Raht, und nimmst mich endlich mit Ehren an.“
Dieses Motto wird fortgeführt in einem zweistrophigen „Air“ für „Cant. sol. con 2 Hautb. et un Viol.“, das hinsichtlich der poetologischen Regeltreue eine - zuweilen experimentell wirkende - Fortentwicklung jener Strophenarie darstellt, die Jauch 11 Jahre zuvor zur Amtseinführung seines Rostocker Magistervaters Möller produziert, präsentiert und publiziert hatte.
Die Verteilung der untypisch knappen, als solche nur durch Beischriften erkennbaren Rezitative auf die Vokalpartien in dialogischer Form legt schließlich nahe, dass die praktische Ausführung von solistischen musikalischen Dilettanten im privaten Umfeld einer Haustrauung erfolgen sollte - und somit im idealen Experimentierfeld für neue poetische und musikalische Gestaltungsformen, für die in offiziellen Haupt-Gottesdiensten zu dieser Zeit (1705) absolut kein Platz denkbar war.
Nicht unerwähnt soll in diesem Zusammenhang die Tatsache bleiben, dass Johann Andreas Stübel - der bislang als Autor der Choralkantatentexte diskutierte Leipziger Pädagoge - zum 12.5.1694 (und somit nur einen Monat vor Jauchs Rostocker Arien-Aufführung und bald nach dessen Besuch in Leipzig) ein Leichengedicht auf Anna Kunigunda Carpzov drucken ließ, dessen Anfangsbuchstaben - zeilenweise untereinander gelesen - den Namen der Verstorbenen abbilden.
Die beiden Texte Stübels und Jauchs bieten im übrigen die willkommene Möglichkeit, die poetische (und das bedeutet zu diesem Zeitpunkt noch auch: poetologische) Kompetenz ihrer Urheber anhand gleichzeitig entstandener Beispiele zu vergleichen, wobei freilich 15 Jahre Unterschiede im Lebensalter in Rechnung gestellt werden müssen.
Johann Christoph Jauchs Vorliebe für selbstbezügliche Buchstabenspielereien zeigt sich bereits im Kopf des Titelblatts seiner Rostocker Magisterdisputation aus dem Jahr 1695:
[J]esu [C]hristo [J]uvante
Ein weiteres Beispiel: Im prima vista anonym erschienenen Druck anlässlich der Wiederverehelichung des Lüneburger Michaelis-Pastors Johann Jacob Boje (alias Boye, Boie; 1671-1729) am 17. April 1703 nach dem Tod seiner ersten Ehefrau und deren beiden Kindern mit Anna Maria, einer Tochter des Lamberti-Predigers (und somit direkten, dienstälteren Kollegen im Predigtamt und „Senior Ministerii“) Friedrich Georg Koltemann (1702 Taufpate von Jauchs Tochter Sara Maria und 1704 von dessen Sohn Tobias Christoph), gibt der Autor sich zu erkennen als:
Einer über das gnädige Andencken GOTTES
[M]it [J]hnen [C]hristlich [J]auchzender
was aufgrund der personellen Beziehungen zweifelsohne lesbar ist als:
[M]agister [J]ohann [Christ]oph [Jauch]
Inhaltlich versucht Jauch die prinzipbedingt abwechslungsarme Form (in Summa 90 Alexandriner-Zeilen) durch das rhetorische Stilmittel eines repetierenden und variierenden Redeschmucks (Ornatus) zu bereichern, indem er ungezählte Zitate, aber auch Umspielungen und Reime des Wortstammes „…denck…“ verwendt, der aus der Devise des Gedenk-Sonntags Riminiscere (5. März; explitzit genannter Tag der Verlobung des Paares) abgeleitet ist: „Der HErr dencket an uns, und segnet uns.“ (Ps. 115,12). Das beginnt bereits in der Einleitung zur Andeutung der Autorschaft: „… das gnädige Andencken …“.
Der Text stellt eine kennenswerte Parallele zu J.S. Bachs stilkritisch extrem früh einzuordnender, quellenkritisch leider undatierbaren Kantate BWV 196 auf denselben Psalm (Vers 12 bis 15) dar. Während Jauchs Worte (15 Strophen zu je sechs Zeilen; wohl kaum als Vorlage für eine damals „moderne“ musikalische Darbietung gedacht) eindeutig für die Wiederverheiratung eines noch nicht lange im Amt befindlichen, auf jeden Fall aber sozial bestens integrierten Geistlichen (belegt durch fast ein Dutzend weitere gedruckte Glückwünsche) bestimmt waren, ist dies für Bachs frühe Komposition nur eine von mehreren der von der Forschung erwogenen Möglichkeiten. Zur Diskussion stehen neben der Vermählung des Arnstädter Pfarrers Johann Lorenz Stauber (17.10.1707) auch Bachs eigene Trauung mit seiner ersten Frau Maria Barbara Bach in Dornheim (5.6.1708). Das schließt eine Mehrfachverwendung (1703, 1707, 1708; sowie zur Zeit der Abschrift des Überlieferungsträgers durch J.L. Dietel um 1730) - rein systemisch betrachtet - keineswegs aus.
Der junge J.S. Bach dürfte dem 1698 zum II. Prediger an St. Michaelis ernannten Boje während seiner Lüneburger Jahre durchaus über den Weg gelaufen sein - was immer sich aus diesem Umstand als Ansatz für weitere Überlegungen ergeben könnte. Zum Beispiel die Frage nach dem Beichtvater des frisch dem Konfirmandenalter entsprungenen Lüneburger Chorsängers.
Weiterhin ergibt sich die Frage nach einem eventuellen karrieretaktischen Zweck einer Komposition wie BWV 196. Wenige Monate nach dem genannten Ergeignis, nämlich Anfang September 1703, starb der - damals mehr denn heute hochgerühmte - Lüneburger Nikolai-Organist Johann Jakob Löwe von Eisenach. Selbst wenn Bach damals schon der Umstand bekannt gewesen sein sollte, dass dessen am 11.12.1703 angetretene Nachfolge an der Nikolai- und an der Marienkirche bereits 1696 Georg Ernst Blech, einem Sohn des Michaelis-Kantors, zugesagt worden war (der sich übrigens erfolgreich einer Verpflichtung zur Einheirat in die Familie seines Vorgängers erwehrt hatte, vgl. Walter 1967), dürfte ihn das kaum an dem Versuch gehindert haben, seiner noch sehr jungen Karriere als Weimarischer Lakai und Hilfsgeiger (vielleicht besser beschrieben als Hilfslakai und potentieller Top-Geiger?) durch eine derartige Initiativbewerbung aufgeholfen zu haben. BWV 196 wäre demnach als eine Art „Probestück“ zu betrachten - angereget durch das im Jauchschen Text intensiv behandelte Dictum. Zur stilistischen Beeinflussung durch internationale „Stars“ wie Torelli und Albinoni durch den im Januar 1703 mit vielversprechenden Notenkäufen aus Venedig nach Weimar zurückgekehrten Kapellmeister-Sohn J.W. Drese vgl. Küster (1996).
Schließlich ist die Rolle eines potentiellen Förderes zu untersuchen. Seit Dezember 1700 amtierte mit dem Landschaftsdirektor Ernst Wilhelm von Spörcken eine Persönlichkeit, die den großräumigen Komplex St. Michaelis bis zum Tod 1726 nicht nur organisatorisch und baulich (grunderneuerter Wohntrakt; neue Orgel), sondern auch durch Förderung von Musik und Theater auf ein bis dahin kaum gekanntes Niveau zu heben vermochte. Freilich ist nicht bekannt, ob um 1703 Aussicht auf eine freie oder zusätzliche Stelle im musikalischen Ensemble der landständischen Bildungsinstitution und ihrer kirchlichen Feierstätte bestand.
Sechs Jahre nach dem Glückwunsch für Boje, nämlich 1709, heißt es im Titel einer Trauermusik für Jauchs Amtsbruder an St. Nicolai, Friedrich Heinrich Oldecop:
Einer der
[M]it [I]Hm [A U C H] [P]flegte [zu] [L]ehren.
was sich lesen lässt als:
[M]agister [I] [AUCH] [P]rediger [zu] [L]üneburg.
Jauchs Vorlieben für derartige Spielereien übertrugen sich auf seinen Sohn Ludolph Friedrich, der 1716 (unter mehr als beiläufiger Erwähnung seines Elternhauses: „Venerandi Domini Parentes“) in einem Schulprogramm am Johanneum zu Ehren des neuerdings im fernen London residierenden Landesherrn König Georg I. dessen Namen in der typographisch (im Nachbarhaus, bei Cornelius Johann von Stern) plakativ gestalteten Form eines klassischen Akrostichons lobpreiste:
[G]loriosus
[E]rectus
[O]ptimus
[R]eligiosus
[G]ratus seu Acceptus
[I]ustus
[V]erax
[S]apiens
Auch an Jauchs - in königlich-polnischen Diensten stehenden - jüngsten Bruder, den angeblich nobilitierten Joachim Daniel „von“ Jauch (1688-1754; eines von 14 Geschwistern), wurde nach dessen Tod mit einem namesbezüglichen Buchstabenspiel von anonymen Beiträgern gedacht. In seinem hinterlassenen „Sztambuch“ (so der apographe Bleistifttitel in dem Exemplar der Nationalbibliothek Warschau; aber wohl eher als ein Sammelalbum zu betrachten, unter dessen zahlreichen Rötel-Portraits leider keine Abbildungen von Familienmitgliedern enthalten sind), findet sich gegen Ende ein posthum eingefügter, emblemartiger Kupferstich (Entwurf oder Abbild eines Grabmals für die Kapuzinerkirche Warschau?) mit einem, aus zwei verschränkten Buchstaben I sowie einem D als Plinthe gebildeten und mit lateinischen Datumsangaben (u.a. demjenigen seiner Konversion drei Tage vor seinem Tod) sowie einem SOLI DEO GLORIA jeweils in Spiegelschrift versehenen Kreuz. (I.D.I = Iohann Daniel Iauch)
Daneben zwei mal zwei übereinander drapierte, plastisch geformte Ziffern, die wohl das Jahr seiner Ernennung zum Generalmajor betreffen: 1746. Darunter ein darauf applizierter Zettel in Typendruck mit folgendem, im Original polnischen Text (Übersetzung unter Ignorierung der diakritischen Zeichen mit DeepL; Hervorhebungen [] hier nach den halbfetten Versalien des Drucks):
„Am dritten Mai habe ich mich unter das Zeichen des Kreuzes begeben,
da ich ein Kreuzritter für den Himmel geworden bin.
Und wenn du nicht weißt, wessen Name in diesem Abriss steht?
Dan[I]el Jo[A]chim im Kre[U]z, und das Kreuz in Joa[CH]im.
Unter diesem Zeichen bin ich der Sieger für immer,
GOTT hat mir seine Gnade erwiesen.“
Man beachte auch in diesem Fall die syntaktische Umstellung (Joachim Daniel -> Daniel Joachim zugunsten der korrekten Konstituierung des linearisierten Achrostichons, das hier zu einem - zusammen mit dem graphischen Emblem - mehrschichtigen Chiasmus überhöht wird - obwohl, oder weil, theoretisch statt Dan[I]el Jo[A]chim auch Joach[I]m D[A]niel möglich gewesen wäre. Und zwar auch in der polnischen Version.
Dass ein schöpferischer Umgang mit einzelnen Lettern seine Tücken haben kann, belegt ein spektakulöser Vorfall während des „Zeithainer Lustlagers“ zu Ehren Augusts des Starken und seiner Gäste 1730. Daniel Jauch hatte ein Feuerwerk arrangieren dürfen (oder vielleicht müssen), welches - wohl durch ein phonetisches Missverständnis der amtlichen polnisch/sächsischen Staatssekretäre - statt eines „VIVAT“ ein missverstehbares „FIFAT“ in den Nachthimmel projizierte, was nachträglich verlegenheitshalber zu „FAUSTA IUBILA FECERUNT AUGUSTI TEMPORA“ verschlimmbessert wurde und welches bis vor wenigen Jahren als selbstironisch genutztes Autoren-Pseudonym in zahlreichen familienbezüglichen Wikipedia-Beiträgen nachzuweisen ist.
Zur Einordnung in den Zeitgeist: ein Beispiel für die Verwendung eines recht einfach gestrickten Anagramms stellt die Umformung des Nachnamens „Teleman(n)“ zu „Melante“ durch den Namensträger selbst dar. Aber bereits im 1732 erschienenen 2. Band des „Zedler-Lexikons“ wird ein solches Verfahren mit Spott überhäuft: „Der Nutzen der hieraus entstehen soll, kann gar nicht angegeben werden, u. die Vergnügung, die sich dabey befindet, gehöret nur vor die schwachen Geister, die sich gerne mit Kleinigkeiten aufhalten. Der gute Geschmack unserer heutigen Gelehrten [Gottsched?] hat dieselben längstens verbannt, und die Satyren-Schreiber haben dieselben hier und dar lächerlich gemacht.“ Offenbar war die Methode des Buchstabentauschs mit Fortschreiten der literarischen Aufklärung von einer poetologischen Gestaltungsmöglichkeit zu einem kryptographisch nutztbaren Nebenzweck degradiert worden.
Den Brückenschlag zu den außergewöhnlichen Zitaten J.N.D.N.J.C. im autographen Kopftitel der Choralkantate BWV 20 und auf dem Umschlag des apographen Überlieferungsträgers der Frühfassung der Matthäus-Passion BWV 244b bildet die zwischen 1705 und 1715 datierte Abschrift einer Michaelisfest-Kantate „di M.B.“ in der Sammlung Bokemeyer auf den Text „Satanas und sein Getümmel“, deren Titel diese Buchstabenfolge anführt:
J.N.D.N.J.C.A.
[I]n [N]omine [D]omini [N]ostri [J]esu [C]hristi [A]men
und die - nach dem seit der Antike in der abendländischen Dichtkunst anerkannten und praktizierten Kunstgriff des „Letterwechsels“ (Anagramm) anders gereiht (und ggf. auch ohne das „Amen“) - eine Art vorangestelltes Kolophon ergeben könnte:
N. D. N. A. J. C. J.
[N]on [D]ele(te) [N]omen [A]uctoris [J]ohann [C]hristoph [J]auch
und die von Kümmerling (1963; 1970) mit dreieinhalb guten Gründen (Stilkritik; Schreiber; Wasserzeichen; buchbinderischer Befund) nicht mehr (wie von Stein 1937/39) [M]onsieur [B]ruhns, sondern [M]onsieur [B]öhm zugeschrieben wurde.
Wer immer diesen nirgendwo sonst nachweisbaren Kantatentext geschaffen hat - er muss in einem besonderen Vertrauensverhältnis zu Böhm gestanden oder auch nur in dessen Region gelebt haben. Der Sammelband D-B Mus.ms. 30101 enthält ausschließlich Werke von drei norddeutsche Komponisten, deren Nachnamen mit „B“ beginnen: Bruhns, Böhm, Brunckhorst. Der gesamte Text bleibt in stilometrischer Hinsicht mit den gesicherten bzw. zugeschriebenen Dichtungen Jauchs unter Berücksichtigung der mutmaßlichen Entstehungszeit abzugleichen.
Über die Gründe J.C. Jauchs, seine Autorschaft nur doppelt verschleiert, nämlich in Form einer intrikaten Kombination von linearisiertem Achrostichon und Anagramm zu dokumentieren, so dass sie zwar für (möglichst wenige?) Eingeweihte erkennbar blieb, lässt sich nur spekulieren. Traute er der literarischen Qualität der Hervorbringungen seiner poetischen Nebenstunden nicht - oder fürchtete er, seiner fortwährend feindlich gesonnenen Umgebung (die o.g. genannten „falschen Brüder“) Angriffsflächen für die Fortsetzung ihrer Intrigen zu bieten?
Nicht unerwähnt soll schließlich die Tatsache bleiben, dass eine der allerfrühesten, in Georg Böhms Komponierstube entstandenen eigenhändigen Notenabschriften des 15jährigen J.S. Bach, die im Mai 2005 in Weimar aufgetauchte Tabulatur von A. Reinkens Orgelfantasie „An Wasserflüssen Babylon“, mit der Invocatio „J.N.J.“ („In Nomine Jesu“) beginnt, wobei das erste „J“ in der Schreibweise etwas abweicht. Gleichwohl: Wer oder was mag den jungen Schüler zur Wahl dieser Anrufung bewogen haben? Die möglicherweise von Böhm geschriebene, mit einiger Sicherheit aber von ihm beschaffte, Kopiervorlage - oder eine Person aus seinem Lüneburger Umfeld des Jahres 1700?
Die Buchstabenfolge „J.N.J.“, die in gedruckten Theologica (z.B. auf dem Titel von Bachs Exemplar der „Calov-Bibel“) gelegentlich auftaucht, ist im musikalischen Kontext um 1700 sehr selten zu finden. Später (ab ca. 1720) verwenden G.P. Telemann und Gottfried Heinrich Stölzel sie gelegentlich bis regelmäßig. Das älteste, bei RISM (190006905) nachgewiesene Zitat ist im Kopftitel einer zwölfstimmigen Kantate von Dietrich Buxtehude auf den Text „Frohlocket mit Händen“ (BuxWV 29) überliefert. Die in der Sammlung Düben befindliche Tabulatur wird um 1680-1690 datiert und dem anonymen, dort singulären Kopisten „HT5“ zugeschrieben.
Im Bachschen Kontext lässt sich „J.N.J“ nur noch ein einziges weiteres Mal nachweisen - leider nicht auf einem Autograph, sondern auf einer 1730/31 datierbaren Abschrift der Kantate BWV 73 von der Hand eines Kopisten namens Gottfried Ernst Sonntag, dem eine unbekannte Zwischenquelle vorgelegen haben muss.
Auf die im engen persönlichen Umfeld Jauchs 1722 verwendeteVariante „J.N.J.A.“ wird im weiteren Verlauf noch einzugehen sein. Und schließlich sei noch die Beobachtung erwähnt, dass sowohl „JCJ“ als auch „JNJ“ als auch die Variante „JNDNJ(C)“ als Buchstaben-Palindrom gelesen werden können.
Und auch dies noch: ein unverdächtiger Zeuge (der im ostfriesischen Emden amtierende Kantor J. Krüger) bezeugt bereits 1819 und somit wohl als Erster eine Deutung von „J.J.“ nicht als - bis heute unreflektiert, permanent neutestamtentlich glorifiziertes „Jesu Juva“ - sondern als alttestamentlich verstehbares „Jehova Juva“. Nicht aus der Luft gegriffen, sondern aufgrund von „mehr als Hundert an der Zal[sic]“ Partituren von Bach-Kantanten. Es fragt sich übrigens: wie und wo hatte Krüger Zugriff auf „mehr als Hundert“ von Bach-Manuskripten? (Vgl. Dok VI, B 111)
Die Zuschreibung der Autorschaft des lange Zeit verschollenen, 1870 (im Vorfeld von Philipp Spittas für fast 150 Jahre lang grundlegenden Bach-Biographie) ohne die entscheidenden Teile veröffentlichten, den folgenreichen Brand der Ratsbücherei 1959 in Form von zwei leidlich lädierten Exemplaren überlebenden Textbuchs der von Georg Böhm 1711 - ein Jahr vor der Uraufführung der Brockes-Passion im nahen Hamburg - dem Lüneburger Rat (zugleich mit einem handschriftlichen Exemplar) gewidmeten Lukas-Passion (Scheitler 2005: deest) ist bislang ungesichert, liegt aufgrund der Übereinstimmung einiger Stilmerkmale mit den Hochzeitskantaten von 1705 und dem 1713/14 erschienenen, auf Texten lokaler Autoren beruhenden Kantatenjahrgang Flors aber durchaus im Bereich des Möglichen. (Vgl. Walter 1967, der neben Jauch auch dessen Vorgänger Wehrenberg - und somit einen der weiteren Beiträger für die insgesamt acht Gratulationen zur o.g. Hochzeit - zur Diskussion stellt.)
Bemerkenswert an diesem Lüneburger Libretto ist diese Dichotomie: Zum einen ziehen sich durch das - somit vielleicht als eine sehr spezielle Form des spät weiterentwickelten Typus der Choral-Passion einzustufende Werk - 14 Strophen „Auß D. Joh. Olearii Passions Liede O Jesu Gottes Lamm etc. in der Melodey O Gott du frommer Gott“ - und zwar jedesmal ausdrücklich an „Die Gemeine“ als ausführendes, nicht nur stumm rezipierendes Organ zugewiesen.
Zum anderen wird das hier wörtlich nacherzählte biblische Narrativ auf eine Weise durch Arien kommentiert, die mit ihrer moderateren Wortwahl (Ausnahme: „… wenn kräht der Gewissens-Hahn …“) näher an dem am „Sermo humilis“ (vgl. Axmacher 1984; Haselböck 2004) orientierten, volksnahen Predigtstil angesiedelt ist als die ein Jahr darauf in Hamburg - unter gänzlich anderen Umständen, nämlich in Form eines spektakulären, auch sprachlich von der zeitgenössischen Oper profitierenden, großbürgerlichen, nur vorgeblich privaten musikalischen Konventikels zelebrierte Brockes-Passion - wie aus der formal und inhaltlich extrem verdichteten Arie Nr. 7 erhellt.
Deren erste drei Zeilen sind offenkundig inpspiriert von einer an analoger Stelle platzierten Aria der „Tochter Zion“ aus Christian Friedrich Hunolds 1706 (im Jahr seiner dramatisch geschilderten Flucht aus Norddeutschland) in Hamburg gedruckten, von Reinhard Keiser schon 1704 vertonten und unter Protesten der Geistlichkeit aufgeführten Passionsoratorium „Der blutige und sterbende Jesus“, wo es u.a heißt:
Besiege diese Nacht […]
Ihr Sünden-Finsternissen,
Entweicht mit Babels Flüssen …“
Böhm vertont diese Worte:
O ungeheure Nacht!
Derer Sünd und Finsternissen
Alle Nächte weichen müssen
Was wird in dir vollbracht?
Der Sonnen Sonne wird verdeckt
Der Stern aus Jacob wird befleckt
Den HErrn verspotten schnöde Knechte
Gott selbsten schlägt der Ungerechte.
Was wird in dir vollbracht.
O ungeheure Nacht.
In diesem Zusammenhang wäre zunächst eine Passage aus der 3. Passionspredigt Heinrich Müllers zu bewerten:
„Schrecklich ist es / daß hie der Knecht den HErrn / die Creatur den Schöpffer / mit der Hand / die der Schöpffer selbst gemachet / schläget in das Angesicht / das aller Engel und Außerwählten Lust und Freude ist.“
und sodann diese seine Worte, die als Nucleus für BW 244b/27b angesehen werden könnten:
„Wunder ist es / daß diesen gottlosen Menschen nicht der Blitz und Donner hat zerschmettert: Daß nicht die Erde ihren Mund auffgethan / und ihn verschlungen. Aber das ist Gottes Langmuth / die noch auff Besserung gewartet hat.“
Mit der betrüblich-empörten Formulierung: „Wunder ist es …daß … nicht der Blitz und Donner …“, die auf zeitgenössische Traditionen zurückweist, ist auch die folgende, von der theologischen Forschung bislang nicht zufriedenstellend erklärte dramaturgische „Fehlstelle“ in der Chronologie der entsprechenden Szene der Matthäus-Passion (BWV 244/27b) aufgelöst.
Dort nämlich wird kein reales Geschehen geschildert, für das es im Bibeltext an dieser Stelle auch gar keinen Beleg gibt, sondern die in ein fiktionales Geschehen gekleidete, innere Beteiligung - das Mitleiden, Mitbeben - der Hörenden über einen zwar erwünschbaren, aber aus soteriologischer Sicht nicht erfüllbaren Eingriff der Schöpfung in das Passionsgeschehen.
Musikalische Konsequenzen: Um „Blitze!“ und „Donner!“ im Satz BWV 244/27b onomatopetisch zu legitimieren, initiiert Bach sie - ohne biblische Erfordernis, rein musikdramaturgisch - in dem vorangehenden Satz BWV 244/27a, wo sie überfallartig in ein Notturno-haftes, als Bass-loses Duett zwischen Sopran und Alt als Blitze („Lasst ihn! Hal-tet!!“) und Donner („Bin-det nicht!!!“) mehrfach buchstäblich in die stille Reflektion des vorherigen, textlich eher als musikalisch hoch dramatischen Geschehens - gleichsam als Echo - hineinblitzen und hineindonnern.
Welcher opernaffine Textautor hätte das besser erfinden können? Welcher bibelaffine Opernkomponist hätte das genialer vertonen können? Einen solchen dramaturgischen Trick: die Rückverlegung auf den allbekannten Topos eines anerkannten, volkstümlichen Predigtproduzenten (Heinrich Müller)? Hier hat Bach ebenso knapp wie genial das biblische Narrativ extendiert - um dessen Sinn theologisch zu unterstreichen und aesthetisch zu überformen.
Genauere stilkritische Analysen, die theologische und sprachliche Parameter berücksichtigen sollten, könnten vielleicht ergeben - auch unabhängig von der Frage nach dem tatsächlichen Autor - dass mit dem Text von Georg Böhms einzig nachweisbarer Passionsvertonung ein konzeptioneller Kern vorliegt, der vielleicht schon 1700 in der Elmenhorst-Arie Nr. 12 praeformiert war:
Entfärbe, hoher Himmel, dich,
Ein Knecht darf seinen König schlagen.
und als dessen Fortschreibung eine 1723/24 unter halbwegs geordneten Umständen auf Leipziger Befindlichkeiten zurechtgeschnittene (und somit zwangsläufig rebiblifizierte) Brockes-Adaption in Gestalt von BWV 245 angesehen werden könnte - und als finaler Entwicklungsschritt schließlich die kunstvoll poetisierte Schilderung der Naturgewalten in BWV 244b.
Die Zuweisungen der mit BWV 245 wiederholt in Verbindung gebrachten Pseudo-Händel-Johannes-Passion (HWV Anh. B 202, auf einen Text des Hamburger Juristen und Operndichters Christian Heinrich Postel), deren künstlerischer Wert „alles andere als unbestreitbar ist“, die grobstrukturell betrachtet streng genommen ein Fragment darstellt und die vielleicht ursprünglich (was keineswegs ohne Beispiel ist) in Tabulatur notiert war, an die norddeutschen Klein- bzw. Kleinstmeister Böhm (vgl. Kümmerling 1986: “satztechnische Nonchalance“) bzw. Ritter (vgl. Marx 1987) sowie die unrettbar erscheinenden Rettungsversuche zugunsten des 19jährigen Georg Friedrich Händel (vgl. zuletzt Kleinertz 2003) können nun noch einmal zur Diskussion gestellt werden, da zwar das um 1740 datierte corpus delicti selbst (D-B Mus.ms. 9001) als Digitalisat vorliegt, nicht hingegen hinreichende Details zur Provenienz der Primärquelle und zum Schreiber der Kopie bekannt sind. Letzterer taucht laut Kümmerling wiederholt als Kopist von Kantaten Böhms in der Sammlung Bokemeyer auf.
Die Namen Christian Flor und Georg Flor könnten bei einer nochmaligen Neubewertung der Urheberdiskussion bzgl. HWV Anh. B 202 zumindest gestreift werden, auch vor dem Hintergrund der vorsichtigen Vermutung, dass hier ein Werk vorliegt, das notationstechnisch nicht aus einem Guss stammt. Freilich wäre eine stilgeschichtliche Lücke von mindestens einem Jahrzehnt zu erklären.
Zum Stichwort „Gewissens-Hahn“ in Böhms Passion ist anzumerken: Die Spur dieses (laut Grimm 6/6321 scheinbar einzigartigen) Kopulativkompositums führt zunächst zu Strophe IV jenes 1675 gedruckten Gedichts des Zittauer Rektors Christian Weise, dessen I. Strophe durch Bach in der Arie „Ach mein Sinn“ der Johannes-Passion BWV 245/13 vertont wurde. Nur 20 Druckzeilen später heißt es bei Weise:
Wird mir gleich der Sünden-Hahn
Im Gewissen krehen müssen
Auf den ersten Blick hat sich somit (spätestens 1724) der Textbeiträger für Bachs Johannes-Passion desselben seltenen Buches („Der grünen Jugend Nothwendige Gedancken“) bedient wie 13 Jahre zuvor der Urheber des Librettos für Georg Böhms Lukas-Passion.
Weise griff nun seinerseits auf eine 1666 publizierte Formulierung aus Heinrich Müllers „Geistlichen Erquickstunden“ zurück. Dieses Werk ist sowohl in Bachs nachgelassener Büchersammlung (Wilhelmi Nr. 42) nachweisbar als auch in Form einer ohne Ortsangabe genannten Auflage von 1720, die als Nr. 1288 in Jauchs Bibliothekskatalog verzeichnet ist. (Vielleicht ein Parallelexemplar zu dem ebenfalls 1720 und ohne Verlagsort katalogisierten Exemplar 0001/8 Asc. 2330 der LMU München?)
Widmungsträgerin der ersten Gesamtausgabe dieser Müllerschen Texte war auf jeden Fall niemand anderes als die unmittelbare Dienstherrin von Jauchs Mutter, die Herzogin Magdalena Sybilla von Mecklenburg-Güstrow. (Ein wohl um 1700 gedrucktes Exemplar einer der bis ins 20. Jahrhundert reichenden, auch auf Ungarisch und Norwegisch erschienenen Auflagen im Eigentum des Verfassers.)
Müller schreibt 1666 unter dem Motto „Vom Lohn der Falschheit“:
„Du denckst, wann der Tuck bewiesen ist, es werd kein Haan darnach krähen, womit wiltu aber den Gewissens-Haan beschwichtigen, der in dir krähet?“
Die Stelle steht bei Müller nur unspezifisch im Passionskontext, denn er bezieht sie nicht - wie bei Weise bzw. Böhm - auf Petri Verleugnung, sondern auf die kommentierende Betrachtung von „Judas Tück / Judas Strick“ - ohne direkte Evangelien-Zitate (Mk 14,27–31; Mt 26,31–35 ; Lk 22,31–34 ; Joh 13,36–38).
Die auffällige Repetition der Stichworte „Strick“, „Netze“ sowie „Gewissen“ („du stellt mir Netze und willt mich fangen“; „dein Gewissen werd dich einmal mit solche Angst bestricken“; „das Gewissen in der letzten Todesnoth mit solcher Angst bestrickt hat“; „Indem du fromme Herzen suchst zu berücken, wirstu nur dich selbst bestricken“) verwendet ein frappierend ähnliches Assoziationsgewebe wie der Eingang der Brockes-Passion („Mich vom Stricke meiner Sünden zu entbinden“) und die - nach bisherigem Kenntnisstand - allein davon abgeleitete Arie „Von den Stricken meiner Sünden“ BWV 245/7.
Müllers - hier in Auszügen analysierte - 49. Andacht endet schließlich mit einem vollständigen Zitat der Choralstrophe „Mir hat die Welt trüglich gericht … viel Netz und heimlich Stricke.“ (Vgl. BWV 244/32; im Torso P 26 in Gestalt von fünfeinhalb skizzenhaft notierten Takten der Sopranstimme als essenzieller Bestandteil vorkomponiert).
Eine weitere Anspielung an Müllers Text:
„Der öffentlichen Hasser gibts viel, noch mehr der falschen Brüder, die unter dem Zucker freundlicher Worte ein Hertzensgifft verbergen, und mit dem Schein gleissender Gebärden die Einfalt betriegen.“
findet sich in der Choralkantate BWV 115 (5.11.1724):
Des Satans List ist ohne Grund,
die Sünder zu bestricken,
brichst du nun selbst den Gnadenbund,
wirst du die Hilfe nie erblicken.
Die ganze Welt und ihre Glieder
sind nichts als falsche Brüder;
doch macht dein Fleisch und Blut
hiebei sich lauter Schmeichelei”
Nicht übersehen werden sollte als weiteres Beispiel für die Auseinandersetzung mit der „Sündenstrick“-Thematik die Arie Nr. 14 aus der noch vorzustellenden Elmenhorst-Edition:
„Durch seine Band und Leidensstrick treibt Jesus unsere Not zurück“
die im Subtitel die biblische Quelle nennt: Ps. 18,6 und mit den Worten beginnt:
„O Todesstrick! Ach, Höllenbande!“
Zum weiteren Aufbau der Lukas-Passion ist ergänzend anzumerken: Den Beschluß bilden (hier ohne Hinweis auf „Die Gemeine“) vier Strophen von Georg Neumarks 1657 erstmals publiziertem Passionslied „Wenn ich denk in meinem Herzen“.
Und schließlich: die frei komponierte Musik von Böhms einzig nachweisbarer Passionsvertonung ist verschollen - es sei denn, man betrachtet das unmittelbar vor diesem Schlußlied erklungene, im Libretto als separater Teil aufgeführte, textlich denkbar knappe „Amen“ als identisch mit dem gleichnamigen, gleichwohl opulent vertonten Schluss-Satz aus dessen erhaltener und als Tonaufnahme verfügbarer Michaelis-Kantate „Satanas und sein Getümmel“.
Jauchs berufliches Wirken konzentrierte sich auf die Sorge für eine, wie er es im Brief an J.J. Syrbius formulierte: „große Gemeine von vielen 1000 Seelen“ - also auf die Verkündigung durch das gesprochene statt durch das gedruckte Wort. Ohne erkennbare Ambitionen auf die Fortsetzung einer akademischen Karriere hatte er vor prominenten Personen, z.B. in der Schlosskirche in Zeitz, vor dem dortigen, von den klandestinen katholischen Ambitionen des Regenten dominierten, durch „ 5. Fürstl. Persohnen“ vertretenen Hof „mit grossem applausu geprediget“, der den verbliebenen mecklenburgischen Familienmitgliedern seiner verstorbenen herzoglichen Förderer dynastisch verbunden war - vielleicht mit der Absicht, doch noch irgendwo zu einer adäquaten Anstellung als Hofprediger zu gelangen. Noch 1718 nimmt er im erwähnten Brief an den Dresdener Superintendenten Löscher Anteil an der allseits erhofften Rückkehr des kurz danach verstorbenen Herzogs Moritz Wilhelm „zu unserer Religion“.
Ein bei näherer Betrachtung durchaus konkreter Beleg für eine individuelle geistliche Betreuung eines prominenten Patriziers findet sich in einer der zahlreichen, 1713 gedruckten Epicedien anlässlich des Todes des Lüneburger Bürgermeisters Friedrich Hermann von Witzendorff - wenngleich offen bleiben muss, ob die übrigen (vielleicht aber auch diese?), meist floskelhaft wirkenden Formulierungen, nicht auf einen nach stichwortartigen Vorgaben agierenden professionellen „Gratulanten“ zurück gehen.
Damals noch auf Platz Fünf in der Anciennität des Geistlichen Ministeriums rangierend (bald vor seiner allseits ungewollten und von ihm selbt ungeliebten Beförderung an dessen Spitze), begnügte der Nicolai-Prediger Jauch sich in seinem pflichtgemäßen Beitrag nicht mit allgemein üblichen Trostsprüchen oder kaprizierte sich gar mit gelahrten griechischen Zitaten, sondern intergrierte sehr konkret („Vierzehn Wochen“) eine Schilderung der Umstände des von ihm offenbar auf dem Sterbebett palliativ-theologisch begleiteten Verblichenen, die hier mit zeilenweisen Auslassungen zitiert werden soll:
Nun kams / nach vieler Last / zwar gantz zum Krancken-Bette
Der Cörper nam nachgrad noch allgemählig ab
Da gings mit Sorge / Furcht / und Hoffnung ümb die Wette
Allein das letzte wahr dennoch der Todt: das Grab. (Syrach 41. V. 1.2.)
Ich komm nur wiederum auff deinen Todt und Sterben
Daß Du Dir selbsten offt / andächtig vorgestellt:
Wie gerne hörtest’ du auff deinem Krancken-Bette
Die geistliche Gespräch von GOtt und seinem Wort
Hierüber muste sichs / so immer hin verweilen
Da Vierzehn Wochen her die Kranckheit fast gewährt /
So warstu schon vorher am Abend gantz bereit.
Da hieß es: Last mich doch mit meinem JEsu ziehen
Daß ich auch selig nun mit JEsu sterben kan:
Nun ist die rechte Zeit: Nun will ich eiligst fliehen
Mit JEsu trete ich den Tod nun freudig an.
„Lasst mich doch mit meinen JEsu ziehen“ - dieses im Druck dezent, aber erkennbar hervorgehobene Zitat fußt augenscheinlich auf jenem 1653 von Sigmund von Birken publizierten Kirchenlied zu einer 1641 veröffentlichen Melodie des Hamburger Jacobi-Organisten Johann Schop, dem langjährigen musikalischen Zuträger von Johann Rist. Somit sicherlich ein Beispiel für die altbewährte lutherische Praxis, Sterbenden mit ihnen, für sie oder um sie herumstehend Choräle zu singen - oder in letzter Not ins Ohr zu sprechen.
Inhaltliche und stilistische Korrespondenzen mit späteren Texten Jauchs bleiben zu untersuchen, desgleichen die Frage, inwieweit es bei der „Rollenverteilung“ von derartigen posthumen Lobhudeleien innerhalb der lokalen „Peer-Group“ formelle oder informelle Usancen gab. Besonders auch hinsichtlich der Frage, welche der Lüneburger Drucker (von Stern; Ortmann; Kelp) jeweils mit derartigen Aufträgen betraut - oder auch nicht betraut - wurden.
Und schließlich: findet sich hier ein Nucleus für die changierende Mischung von rethorisch-poetischem, individual-psychologischem und nicht zuletzt auch theologischem „ICH“, das sich in etlichen der Jauch zuzuschreibenden Kantatentexten um 1724 - bei Vorliegen hinreichender intellektueller Neugier - finden lässt?
1695 hatte der vierundzwanzigjährige J.C.Jauch - wie sich aus einem auszugsweise gedruckten Brief des Kopenhagener Hofpredigers, Universitätsrektors, Kirchenlieddichters und luthertreuen Kontroverstheologen Hector Gottfried Masius an seinen Rostocker Kollegen Johannes Fecht (Jauchs Mentor) ergibt - unter dem Beifall der sämtlichen Zuhörer („totius auditorii applausum“) vor dem jungen dänischen Prinzen Carl (1680-1729) in dessen dortiger Schlosskirche gepredigt - bevor dieser von seinen Erziehungsberechtigten einem allzu „deutschen“ Einfluss entzogen wurde. Die Reise war „auf sein unterthänigstes Ansuchen“ durch Herzog Gustav Adolf „gnädigst vergönnet“ worden, „dessen Stipendiat er war“.
Bei dieser Gelegenheit hatte er sich „mit dasigen [leider ungenannten] berühmten Männern“ (und vielleicht auch mit Urban Gottfried Sieber, nach dessen Studium in Kiel damals Hofmeister nahe Schloss Frederiksborg und später einer der nachgeordneten Nachmittagsprediger während der Leipziger Uraufführungen der Choralkantaten?) „in nützliche discourse … öffters eingelassen“.
Die Gemahlin Augusts des Starken, Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth, lud Jauch (wohl durch Vermittlung ihrer elterlichen Entourage) vor, während oder nach der kontrovers diskutierten Konversion ihres kurfürstlich / königlichen Gemahls zum Predigen während einer „Brunnen-Cur“ in ihre Privatgemächer auf Schloss Pretzsch und in die nahegelegene Stadtkirche ein.
Dort hätte er in Kontakt mit dem späteren Leipziger Thomaspastor und Beichtvater Bachs, Christian Weise d.Ä. treten können, der 1724/25 bei den Uraufführungen eines Teils der Choralkantaten auf der Kanzel stehen sollte. Weise war aufgrund seiner homiletischen Kompetenz von 1696 bis 1699 als Diakonus in das benachbarte Torgau berufen worden und predigte ebenfalls öffentlich und privatim vor der Fürstin.
Dem steht eventuell entgegen, dass dieser Vorgang laut Bertram (1715/19) erst nach Jauchs Bewerbung für Hannover 1705 erfolgt sein soll - freilich ein schwaches Argument in Anbetracht der sehr kursorisch wirkenden Chronologie von Bertrams Erzählweise.
Leider konzentriert sich die ebenso kenntnis- wie materialreiche Dissertation von Silke Herz (2020) auf die kunsthistorische Ausstattung der „Parallel-Residenz“ in Pretzsch. Aber allein die Fülle der dort aufgeführten Archivbelege lässt hoffen, dass - entgegen einigen „Verschwörungstheorien“ in der älteren Forschung - die Quellen nicht nur zu den Realien, sondern auch zum Leben der Kurfürstin und Königin keineswegs verschollen sind oder gar aus ideologischen Gründen kassirt wurden. Separate Hoftagebücher scheint es - im Gegensatz zum Dresdener Hof - nicht gegeben zu haben. Jauchs Besuch könnte aber beispielsweise eine Spur in den Schatullrechnungen hinterlassen haben.
Jauchs besondere seelsorgerische Kompetenz wurde auch propagiert durch ein (ebenfalls von Bertram 1719 kolportiertes) Ereignis, das zu dem sehr speziellen Phänomen der „Maleficantenberichte“ gehört. Demnach hatte er einen zum Tode verurteilten römisch-katholischen Dragoner aus dem Regiment des Generalmajors Villars (Claude-Louis-Hector de Villars, Marschall von Frankreich ) auf dem etwa eine halbe Meile (3 bis 4 Kilometer) langen Weg zur militärischen Exekution durch provisorische Glaubensinstruktion, Examination und Verabreichung des Abendmahls zum „wahren Glaubens-Grund“ überzeugt - nachdem dieser noch kurz zuvor von einem Pater Le Blanche „in einem Gartenhause“ die Heilige Kommunion „nach päbstlicher Weise“ empfangen hatte. (Vgl. Jakubowski-Tiessen 2011)
1725 spielte eine vergleichbare Thematik übrigens eine Rolle in der auch von C.F. Henrici konfessisons-kontrovers ausgeschlachteten Lebensgeschichte des auf spektakuläre Weise ermordeten Dresdner Kreuzkirchen-Pfarrers Hermann Joachim Hahn.
Der 1765 aus dem Nachlass des 1698 erstgeborenen Sohnes, des Lüneburger Michaelis-Pastors Ludolph Friedrich Jauch, kurzfristig samt „Stellagen“ versteigerte Bibliotheksbestand ermöglicht anhand eines Auktionskatalogs, der etwa 5.000 Bände, Konvolute, Faszikel und leider nicht näher spezifizierte Kapseln verzeichnet, detaillierte Einblicke in Bildungsstand und Interessenlage der beiden Besitzer, wobei (möglicherweise erhebliche, teilweise verfolgbare) Abspaltungen im Rahmen einer mutmaßlichen Erbteilung 1725ff ebenso im Blick behalten werden müssen wie die offenkundigen Zukäufe nach dem Tod des Erstbesitzers. (Privates Digitalisat des einzigen erhaltenen Exemplars sowie eine kostenintensiv daraus entwickelte Datenbank im Besitz des Verfassers.)
Bislang konnte immerhin ein konkretes Werk aus diesem Bestand nachgewiesen werden: Ein in der GWLB Hannover (Signatur: T-A262:1) überliefertes Exemplar des „Codex Pseudepigraphus Veteris Testamenti“ des Hamburger Rektors Johann Albert Fabricius, (2. Auflage Hamburg 1722; Katalog Nrn. 2792 und 2793) trägt einen eigenhändigen, bei der bibliothekarischen Erfassung als „Jauch, Ludwig Friedrich“ nicht ganz korrekt aufgelösten Besitzeintrag - wohinter sich mit einiger Sicherheit Ludolph Friedrich verbirgt, den sein Vater einst in die Obhut des Hamburger Gelehrten zu übergeben versucht hatte. (s.o.)
Auf Johann Christoph Jauch dürfte zum Beispiel die Anschaffung jener achtbändigen Ausgabe des 1697 erschienenen „Wagnerschen Gesangbuchs“ zurückgehen (Nr. 2645 - 2652 des Katalogs), einer enzyklopädischen, allein schon aus materiellen Gründen keineswegs für den Massengebrauch konzipierten Choraltext-Anthologie, die auch als wesentlicher Bestandteil der theologischen Bibliothek Bachs belegt ist. Damit ist die Voraussetzung für die Annahme gegeben, dass sich Dichter und Komponist bei einer Abstimmung über das hymnologische Programm der Choralkantaten auf das gleiche, umfangreiche Repertorium von Kirchenliedern stützen konnten. Freilich, ohne dass bekannt ist, wann welche der 1750 buchstäblich posthum verzeichneten Reste aus Bachs Bibliothek jeweils in seinen Besitz gelangten - aber das kennzeichnet das systemische Risiko aller Spekulationen über die Hinterlassenschaften des Thomaskantors.
Wie dem auch sei: Je vier Titel von zwei prominenten Vertretern der Norddeutschen Reformorthodoxie, nämlich August Pfeiffer (Lübeck) und Heinrich Müller (Rostock), belegen zudem - zusammen mit weiteren Werken anderer Autoren - eine quantitativ mit 23 bzw. 32 Prozent beachtenswerte, theologisch durchaus tendenziöse Schnittmenge der hinterlassenen Bibliotheken Bachs und seines Hauptlibrettisten. (Vgl. Wilhelmi 1979: Nrn. 5, 8, 10 sic!, 11,14, 20, 36, 38, 39, 42, 51, 52 sowie die Zweifelsfälle 2, 7, 13, 35, 45.)
Zu erwähnen bleibt schließlich die Tatsache, dass unter Nr. 1881 des Iauch-Katalogs ein Exemplar des 1720 in Hamburg bei Trausold erschienenen Neuen Testaments verzeichnet ist, welches „also gedrucket, daß alle Worte und Reden, Welche der HErr JESUS selber gesprochen, Mit rothen Littern, Die übrige Haupt-Sprüche aber in schwartzem Abdruck, Mit grösseren Buchstaben, Zu lesen sind.“ Dieses typographische Unikat erinnert an den Umstand, dass das Autograph der Matthäus-Passion (und vielleicht auch schon die verschollene Originalhandschrift der Frühfassung und vielleicht auch deren Textvorlage?) für das explizite Bibelwort und für den Cantus firmus des Exordiums rote Tinte verwendet - durch wen auch immer Bach zu dieser außergewöhnlichen Gestaltungsweise angeregt worden sein mag.
Von Jauchs Musikliebe zeugen, neben einer anrührenden Bemerkung über sein durch Kindergeschrei gestörtes „Saiten-Spiel“ in dem Trauergedicht seines Sohnes Ludolph Friedrich, seinen eigenen Worten im Titel der Hochzeitskantate für den Lamberti-Organisten Georg Flor 1705 („… aus Nachbarlicher Freundschafft auch Liebe zur Music entworffen …“) sowie dem Vortrag einer selbst gedichteten, wohl auf Kosten des zu Ehrenden gedruckten, laut Titel während(!) der Rostocker Antrittsvorlesung seines Magistervaters Johann Gottlieb Möller vorgetragenen (zur Begleitung der selbst geschlagenen Laute improvisierten?) Strophenarie - vor allem seine Rolle als beiläufig genannter, gleichwohl federführend tätiger Kurator einer neu geordneten, auf 100 Stücke vergrößerten und mit biblischen Sinnsprüchen angereicherten Ausgabe der „Elmenhorst-Lieder“ für das Lüneburger Verlagshaus von Stern.
Der „in jener Zeit“ - also im Frühjahr 1700 während der Arbeiten an der Elmenhorst-Edition, - knapp zwei Jahre alte und somit sicherlich mehr „lallende“ als „ein sinnreich Wort“ absondernde Ludolph lässt 1725 zum Tod seines Vaters u.a. folgende Zeilen drucken:
Der Kindheit denck’ ich nicht
Vielleicht hat schon mein Weinen
Und dessen wimmerndes Gethön
Mehr als dein Saiten-Spiel,
das doch so rein und schön
Dir müssen angenehme scheinen
Es war dein sehr beredter Mund
Nicht hier allein berühmt und kund:
Doch hat in jener Zeit vielleicht mein kindlich Lallen
Mehr als ein sinnreich Wort dir müssen wol gefallen.
Dein Wille gab vielleicht, wenn hier die Einfalt sprach
Mir liebreich nach.
Die 1911 in Band 45 der Denkmäler Deutscher Tonkunst von J. Kromolicki und W. Krabbe nach zeitgemäßen musikwissenschaftlichen Prinzipien aufbereitete Edition der „Elmenhorst-Lieder“ wurde - laut den exakt datierten Vorworten des langjährigen Autors und Namensgebers, des Hamburger Katharinen-Predigers und Operndichters Heinrich Elmenhorst (20. April 1700) und des Herausgebers, des damaligen Lüneburger Superintendenten Heinrich Jonathan Wehrenberg (16. März 1700) in jenem Frühjahr des Jahres 1700 abgeschlossen, in welchem der 15jährige, bald darauf seiner stimmphysiologischen Existenzgrundlage entledigte Sopranist Johann Sebastian Bach, (wohl ab 3. April 1700, spätestens aber zum 1. Mai1700) in Lüneburg ansässig wurde und dort in der Wohnung des Johannis-Organisten Georg Böhm, wo er Tabulatur-Musiken Hamburger, Lübecker und Lüneburger Orgelmeister inkorporierte, dem damaligen Lamberti-Diakon, Kurator dieser Neuausgabe, zunächst Schützling und später Nachfolger Wehrenbergs - Johann Christoph Jauch - begegnet sein dürfte, während dieser mit Böhm an der Schlusskorrektur des Projekts arbeitete.
Die überregionale Inverkehrbringung durch den Drucker und Verleger Johann von Stern - der damit sein (von wem finanziertes?) musiktypographisch anspruchsvollstes Projekt vorlegte - erfolgte mit Sicherheit nicht vor der Leipziger Michaelismesse (ab 29.9.1700), da zur Ostermesse (ab 11.4.1700) noch nicht sämtliche Vorreden geschrieben und gedruckt waren.
In Hinsicht auf die wohl schon auf diese frühe Zeit zurück gehende Beziehung Bachs zum Hamburger Katharinen-Organisten J. Adam Reincken (dessen Raum- und Zeit-greifende Choralfantasie „An Wasserflüssen Babylon“ er in dieser Phase abschrieb) lässt sich aufgrund dieser Faktenlage annehmen, daß sie nicht - wie bisher vermutet - allein durch Böhm vermittelt wurde, sondern vielleicht auch durch die selbstbezeugte enge Freundschaft Wehrenbergs mit seinem Hamburger Kollegen Elmenhorst angeregt wurde, der mehr als vier Jahrzehnte lang mehrmals wöchentlich während Reinckens musikalischer Gottesdienstgestaltung auf der Kanzel von St. Katharinen predigte.
Jauchs Anteil scheint sich auf den ersten Blick in dem zu erschöpfen, was das Titelblatt mit diesen lakonischen Worten bezeichnet:
„… Auch in gewissen Abtheilungen geordnet von M. Johann Christoph Jauch Prediger zu S. Lamberti in Lüneburg.“
wobei aber auch die vorangehende Zeile mitgelesen werden sollte:
„… und mit beygefügten Grund-Sprüchen heiliger Schrifft und sonderlichen Uberschrifften bemercket, …“
Dieses Zitat belegt die Bemühungen der theologisch konkret Verantwortlichen um eine deutliche Legitimation des gesamten Projekts anhand von unwiderlegbaren Bibelzitaten - vielleicht auch, um nicht in den Ruf von pietistischen Schwärmereien zu geraten?
Von Georg Böhm stammen nicht nur die Vertonungen von 23 der 27 neu hinzugefügten Strophenarien, er dürfte auch für die endgültig modernisierte musikalische Gestalt der kompletten Sammlung in Richtung auf Generalbasslieder mit betont unsanglicher Basstimme verantwortlich gewesen sein, die in den ersten beiden Auflagen von dem (unter mysteriösen Umständen aus der Musikgeschichte entfleuchten) Johann Wolfgang Franck und 1700 zum verbleibenden Teil auch vom Kieler Kantor Peter Laurentius Wockenfuß komponiert wurden.
Elmenhorsts Passions-Arie Nr. 12 scheint mit den Anfangsworten:
Ihr Töchter Zion, gehet her,
Mit Seufzen, Ächzen, Weheklagen
auf die theologisch (gehet -> kommt, helft), aber auch poetologisch (durch geschickte Reduktion auf eine einzige achtsilbige trochäische Zeile) genial umgedeutete und verdichtete Form zum Auftakt des ein Vierteljahrhundert später entstandenen Exordiums von BWV 244b vorauszuweisen:
Kommt Ihr Töchter, helft mir klagen
Staunenswert ist ferner, dass diese Sammlung eine Rezeptionsgeschichte aufweist, die sich durch das gesamte 19. Jahrhundert zieht und sich nicht auf gelegentliche Abdrucke von einzelnen Sätzen in Sammelwerken beschränkt, sondern auch in der aufstrebenden hymnologischen Forschung (Wackernagel, Koch etc.) nachhaltige Beachtung findet. In der heutigen Aufführungspraxis ist sie leider nur mit wenigen, kurzen Auszügen repräsentiert.
Sie beginnt aber schon kurz nach ihrer Erstveröffentlichung 1681, deren Titelblatt übrigens unter der Invocatio „J.J.N“ = „In Jesu Namen“ steht. Zunächst mit einer „Cantata“ des kaum bekannten, am 1.2.1692 (also noch während Jauchs Studienaufenthalt) in Jena immatrikulierten Johann Magnus Knüpfer (1661-1715) auf den Text „Wie seh ich dich mein Jesu bluten“ (Nr. 16), die 1690, 1696 und 1715 von Samuel Jacobi mit der Kantorei der Fürstenschule Grimma aufgeführt wurde (vgl. RISM u. Scheitler 2018)
Ferner mit zwei weiteren Arien, die im Textbuch einer - punktuell krass antijüdisch formulierten - Johannes-Passion auftauchen, welche 1704 vom Musikdirektor am Hamburger Dom, Friedrich Nikolaus Brauns, „abgesungen“ wurde: „Die bittre Trauerzeit beginnet abermal“ (Nr. 10) und „Jesus neigt sein Haupt und stirbt“ (Nr. 20).
Da die Musik dieser Hamburger Johannes-Passion (mit Ausnahme der beiden erwähnten, in welcher Gestalt wie auch immer integrierten Elmenhorst-Arien, denen jeweils ein „Ritornello“ folgt) nicht erhalten ist, lässt sich über deren Komponisten wenig Gewissheit erlangen .
Aber auch dieses Werk hat eine kleine Nachgeschichte: Die Sopran-Arie „Verbirge mich und schließ mich ein“ fungiert noch 1772 als Choralstrophe (Nr. 19) in dem Passions-Pasticcio C.P.E. Bachs (H 785), das auf Werken seines Vaters (BWV 245/39), G.H. Stölzels, G.A. Homilius’ und - was den Choraltext betrifft - auf der Johannes-Passion G.P. Telemanns aus dem Jahr 1745 beruht (TWV 5:30). Das Beispiel belegt die erstaunliche Langlebigkeit mancher Texte.
Brauns (alias Bruhns) gilt als einer der mutmaßlichen Komponisten (als wahrscheinlicher gelten Reinhard Keiser oder dessen Vater Gottfried) jener wohl um 1702 entstandenen Markuspassion (nicht identisch mit BWV 247), die J.S. Bach 1713 in Weimar sowie 1726 und später in Leipzig - mit erheblichen strukturellen Eingriffen - zu Gehör brachte (vgl. Melamed 1999; Blanken 2008).
Mit dem Namen Keiser lässt sich eine möglich erscheinende Aufführung oder auch nur das Vorhandensein der „Hamburger Markuspassion“ (so die Nomenklatur lt. Wikipedia) in Lüneburg in Verbindung bringen. Denn: Johann Matthesson kolportiert 1740 in seiner „Ehrenpforte“, der Patrizier und Musikkenner Brandan Ludolph Stöterogge sei mit Gottfried Keiser, dem Vater Reinhard Keisers, bekannt gewesen und habe Kompositionen von ihm besessen. (Vgl. Walter 1967). Sollte diese Passion darunter gewesen sein, so stellt sich die Frage: Wurde sie in Lüneburg auch aufgeführt? Wenn ja - wann und wo? Und besonders: Vielleicht gar zu einem Zeitpunkt (1700, 01, 02, …), als J.S. Bach wohl gerade noch in der Stadt weilte und sich Gedanken über seine weitere Karriere machen musste? Wie dem auch sei - bei den Stöterogges handelte sich wie eingangs erwähnt um die frühen und wohl auch lebenslangen „Gönner“ Johann Christoph Jauchs.
Mit „Die bittre Leidenszeit“ (statt „Trauerzeit“) liegt schließlich ein Elmenhorst-Elaborat vor, das es zu offiziellen Bach-Ehren geschafft hat: Der textlich, melodisch und basstechnisch gegenüber 1681 (Nr. II.1), 1685 (Nr. 8) und 1700 (Nr. 10) endültig eleganter gestaltete, im Kern aber identische Satz (BWV 450; Zahn 7429) aus der 1736 erschienenen Sammlung des Zeitzer Schlosskantors Georg Christian Schemelli kann zwar nicht als Erfindung des Thomaskantors gelten, ist aber laut Vorwort von ihm „verbessert“ und somit in der Alten und in der Neuen Bach Ausgabe berücksichtigt worden.
Es bleibt verlockend sich vorzustellen, ob und in welcher Gestalt der junge Bach im Sommer 1700 diesen und weitere Sätze in der Komponierstube Böhms (aus dessen Manuskripten, aus einer eigenen Abschrift, aus den Korrekturfahnen oder Fehldrucken der Offizin von Stern oder aus deren druckfeuchtem Endprodukt?) gesungen haben könnte, zu Böhms, seiner eigenen oder eines interessierten Lautenisten oder Cembalisten Begleitung - in Gegenwart des Herausgebers und vielleicht auch des Kurators der Sammlung - so lange, bis seine „schöne Sopranstimme“ (acht Tage vor der endgültigen Mutation) zu oktavieren begann - was eine Weiterführung der Gesangsversuche in einer anderen Stimmlage aber nur vorübergehend verzögert haben dürfte.
Böhm bewohnte zu jener Zeit (1700) an der Neuen Sülze Nr. 9 eine Wohnung Wand an Wand mit dem repräsentativen, 1802 im klassizistischen Stil erneuerten, 1962 vermeintlich gutwillig eliminierten, zuvor fachgerecht dokumentierten, ursprünglich mit qualitätvollen Terakotten aus der Spätrenaissance geschmückten Haupthaus (Nr. 8) des Ratssyndikus Tobias Reimers (Taufpate von Jauchs 1704 geborenem Sohn Tobias), eines ausgewiesenen Musikliebhabers, in dessen (von Zacharias Conrad von Uffenbach beschriebener, reichsweit gerühmter) Realien-Sammlung sich auch eine „Angélique“ befand, „die sehr künstlich eingelegt war“ - eine insbesonders am Mecklenburgischen Hof nachweisbare Sonderform der Laute, also wohl ein Exemplar aus der Werkstatt des Hamburger Instrumentenmachers Joachim Tielke. (Vgl. Tschirner 2020)
Auch eine Tochter des Taufpaten von Jauchs zweitem Sohn Ludolph, die 1722 als protestantische Äbtissin zu Medingen gestorbene Elisabeth Catharina von Stöterogge (Schwägerin Reimers), galt nicht nur literarisch und theologisch als hochbegabt, sondern sollte „auf der Laute fast nicht ihres gleichen haben“.
Die Verwendung obligater, später auf leichter realisierbarere und besser hörbarere Besetzungen zurückgeführter Lautenpartien in Bachs beiden großen Passionen ist vor dem Hintergrund zu überdenken, ob hier ursprünglich subtile Reverenzen an musikalisch entsprechend motivierbare Interessenten eine Rolle gespielt haben könnten.
Gänzlich im Bereich der Spekulation müssen vorerst Überlegungen bleiben, ob und in welchem Umfang es zum Austausch von Aufführungsmaterial zwischen Leipzig und Lüneburg gekommen sein könnte.
Das betrifft beide Richtungen: Sowohl die Frage nach der Herkunft der Vorlagen für Bachs sehr spät datierte Kopie von Georg Friedrich Händels Brockes-Passion (HWV 48), als auch die nach der Partitur (die Stimmen wurden nachweislich vor Ort angefertigt) für die recht frühe Aufführung dieses Werks in St. Michaelis am 16.3.1723) - wohl kaum ohne kirchenamtliche Zensur oder zumindest Kenntnisnahme durch den Superintendenten Jauch und durch Einfügung eines gesprochenen(!) „Unser Vater“ (vgl. Frederichs 1975) zudem ansatzweise reliturgisiert und schon im Vorfeld seitens Johann Mattheson publizistisch ungewöhnlich wohlwollend begleitet - als auch Überlegungen hinsichtlich der Orte, wohin die von Bach praktizierten oder auch nur beabsichtigten Ausleihen seiner eigenen Passionen und Kantaten bzw. deren Libretti erfolgt sein könnten, wären unter diesem Aspekt zu untersuchen.
Die Tatsache, dass 1717 für eine - leider nicht näher spezifizierte - Passionsaufführung in St. Michaelis die erstaunlich hohe Anzahl von 1000 Textheften in den Kirchenrechnungen verzeichnet wurde (also nicht, wie etwas später in Leipzig, auf die private, im letzten dokumentierten Fall wohl bis heute unbeglichene Rechnung des dortigen Kantors; vgl. DOK II, ...), belegt auf jeden Fall, dass unter den - zumindest passiv beteiligten - Augen und Ohren eines theologisch und musikalisch hochkompetenten Geistlichen wie J.C. Jauch immer wieder auch Kirchenmusiken praktiziert wurden, die über liturgische Allerweltsereignisse hinaus reichten.
1722 entstand im damals führenden Bibel- und Gesangbuchverlag nördlich des Mains, der heute in 14. Generation in Familienbesitz befindlichen von Sternschen Druckerei, in dem Gebäudekomplex „Am Sande Nr. 31“ und somit fast Tür an Tür mit Jauchs damaliger Dienstwohnung („Am Sande Nr. 27“, einst die „Alte Probstei“, später das 50 Schritte nördlich neben dem Westportal von St. Johannis gelegene, kirchlich geführte „Café Sandkrug“ - seit 2023 als Bildungs- und Kulturzentrum „DÜNE“ bis auf weiteres zwischengenutzt), die zweite Auflage (von insgesamt mindestens neun, mit einem geschätzten Aufwand von jeweils etwa 50 Mannwochen erstellten, inhaltlich identischen, aber nicht exakt anastatischen Neudrucken) der Passionspredigten (Anhang zum „Hertzensspiegel“) des 1675 verstorbenen Rostocker Superintendenten und Theologieprofessors Heinrich Müller. (Je eines der - allesamt in Norddeutschland überlieferten - Exemplare der ca. 1800 Seiten umfassenden Auflagen Lüneburg 1722, 1736, 1743 und 1752 im Eigentum des Verfassers.)
Diese Tatsache lässt kaum eine andere Annahme zu, als die, dass Johann Christoph Jauch diesen Text (in exakt dieser Variante), an dessen Imprimatur er qua Amt auch beteiligt gewesen sein musste (vgl. Wricke 1973), sehr genau gekannt hat, der nach dem oft zitierten, aber leider angegrauten (weil nie fortgeschriebenen) Stand der Forschung (Axmacher 1978; 1984) in Form auffälliger Allusionen zumindest in das sprachmotivische, wenn nicht auch in das theologische Gerüst von Bachs Matthäus-Passion einfloss - und auch in einzelne Choralkantatentexte.
Während der Erstdruck der überwiegend in Lüneburg, aber auch in weiteren norddeutschen Verlagsorten wie Hamburg, Ratzeburg und Stade, recht spät auch in Rostock, ferner in Minden und unter besonderen Umständen sogar in Unna (jedoch nie in Leipzig) das gesamte 18. Jahrhundert lang kontinuierlich nachgedruckten Ausgabe des „Hertzensspiegels“ mit seinen stets beigefügten Passionspredigten auf Übertragungen eigenhändiger, bezeugtermaßen schwer entzifferbarer Predigtkonzepte durch Müllers Privatsekretär und Nachlassverwalter Johann Caspar Heinisius beruhte, fußte die Edition aus Bachs Bibliothek auf simplifizierenden Mitschriften der gesprochenen Predigten durch einen weiteren Rostocker Theologiestudenten - Samuel Christian Mummius - der eine abweichende Aufteilung der acht bzw. neun, ursprünglich aus reinem Fließtext bestehenden Predigtblöcke wählte und gegen Ende des Rohmaterials auf die weitgehend wörtlich übernommene Heinisius-Edition zurückgriff. (Vgl. Franklin 2015b). Elke Axmacher hat diese Unterschiede bereits erkannt, konnte jedoch keine Erklärung für deren Ursachen liefern. Zu ihrer Zeit war die heutige „digitale Dividende“ noch nicht absehbar, deren Nutzen aus der elektronischen Erfassung, Katalogisierung und Präsentation historischer Dokumente resultiert.
Die letzten fünf Zeilen des zweiten Satzes der Choralkantate BWV 2 (18.6.1724) finden beispielsweise eine Entsprechung in der „Lüneburger“ Edition der siebenten Passionspredigt Müllers. Sie ist deutlich detailgenauer (im Sinne einer Lectio difficilior und entgegen ephemerer KI-Einschätzungen) als jene Variante in der inhaltlich stark verkürzten, als „Evangelisches Praeservativ“ sehr selten aufgelegten Mummius-Ausgabe von 1681 aus Bachs 1750 nachgelassener Bibliothek, die bislang als einziges Indiz für die Zugriffsmöglichkeit Bachs bzw. Henricis auf den Müller-Text vermutet wird.
Ein Rohr hat von aussen ein schönes Ansehen,
und ist doch inwendig leer.
(Müller, 7. Passionspredigt, nach dem sehr seltenen Eemplar des „Evangelisches Praeservativ“, 1681, aus Bachs Nachlass.)
Wir sind wie ein Rohr in unserer Heucheley.
Außwendig gleissen wir schön,
inwendig aber ist lauter Unflath,
gleich den übertünchten Gräbern,
die außwendig schön gefärbet seyn,
inwendig aber voller Todten-Knochen seyn.
(Müller, 7. Passionspredigt, nach den norddeutschen, speziell „Lüneburger“ Editionen 1715, 1722ff.)
Sie gleichen denen Totengräbern,
die, ob sie zwar von außen schön,
nur Stank und Moder in sich fassen
und lauter Unflat sehen lassen.
(BWV 2/2, zum 18.6.1724)
Dieser Befund ermöglicht - neben dem Nachweis einer gekonnten, keineswegs übermäßig gekünstelt (oder nach Müllers eigenen Worten: „geblümelt“ ) wirkenden (z.B. durch das Wechselspiel „inwendig / auswendig; auswendig / inwendig) poetischen Verdichtung von vorgefundenen Sprachmotiven - die Annahme, dass sich Autor und Komponist von Anfang an um eine gemeinsame Inspirationsquelle für Kantaten und Passion bemüht haben. Es bleibt zu prüfen, ob und aufgrund welcher Quelle bei der Wiederaufnahme der Arbeiten an der Passion zwischen 1727 und 1729 Müllers Predigtreihe wiederum hinzugezogen wurde.
Die Beauftragung von Bachs „Lüneburgischem Lehrmeister“ Georg Böhm mit der Vertonung einer ganzen Reihe von ergänzenden, besonders auch die Passion betreffenden Texten für die 1681 und 1685 in Hamburg, dann im Frühjahr 1700 (aufgrund der großen Nachfrage zum dritten Mal und nun im Stern-Verlag mit hohem technischem und personellem Aufwand) produzierten, von Auflage zu Auflage musikalisch modernisierten „Elmenhorst-Lieder“ dürfte ebenso auf Jauch zurückgehen wie vielleicht schon die Anregung für die Berufung des zeitweiligen Hamburger Operncembalisten Böhm nach Lüneburg im Jahr 1698, den er wenige Jahre zuvor, während seines Studiums in Jena, kennen gelernt haben könnte.
In Jena war Jauch Mitstudent u.a. auch von Johann Christoph Olearius, Johann Avenarius, Johann Christoph Wentzel, Johann Burchard Freystein und von Johann Nikolaus Bach - und somit teilnehmender Beobachter eines hymnologischen Netzwerks, das ab 1700 eine gemäßigt orthodoxe, eher fachpublizistisch fundierte als populistisch relevante Parallelströmung zu den musikalischen Aktivitäten des Hallischen Pietismus und dessen Gründervaters August Hermann Francke entwickeln sollte, der einige Jahre zuvor (als Gast des damaligen Superintendenten Sandhagen) in Jauchs späterer Lüneburger Dienstwohnung sein autobiographisch bezeugtes Erweckungserlebnis gehabt hatte.
Erste Eindrücke einer außergewöhnlichen, aus nord- und mitteldeutschen Traditionen schöpfenden Gesangbuchkultur dürfte der sehr junge Jauch bereits auf Schloss Güstrow aus zweiter Hand durch seine Mutter Ingeborg Nicolai erfahren haben, einer Kammerzofe der dorthin vermählten Herzogin Magdalena Sybilla von Holstein-Gottorf, die bereits in ihrem Geburtsort Husum in deren Dienste getreten war.
Magdalena Sibyllas in der reichen musikalischen und theologischen Tradition des Dresdener Hofs aufgewachsene Mutter Maria Elisabeth hatte 1676 durch ihren Hofprediger Petrus Petraeus (vulgo: Peter Petersen) ein keineswegs nur konservativ kuratiertes Hofgesangbuch zusammenstellen lassen (Gojowy 1978: deest), das neben dem Rückgriff auf das sakrosankte Repertoire des Reformationsjahrhunderts auch ausgiebige Anleihen bei Paul Gerhardt, Johann Rist und bei Heinrich Müllers „Seelen-Musik“ machte.
Das Kirchenliedrepertorie ähnelt zumindest vom zeiträumlichen Zuschnitt durchaus demjenigen der Choralkantaten J.S. Bachs. Eine Spurensuche nach Übereinstimmungen bei den Perikopen- bzw. de tempore-Zuordnungen oder gar nach kongruenten orthographischen Varianten könnte Gegenstand von Spezialstudien sein.
In den dort versammelten ca. 400 Choraltexten finden sich etliche Beispiele für Akrosticha aus der Feder des Petraeus, durch die nicht nur die Namen der adeligen Verwandtschaft (z.B. der Tochter Sophia Amalia), sondern auch diejenigen von bürgerlichen Hofbediensteten wie z.B. „CammerJungfern“ durch typographisch dezent markierte Anfangsbuchstaben der Strophen benannt werden.
Von mindestens einer der Schwestern Magdelena Sybillas ist überliefert, dass sie das teils mit Noten versehene, in Großschrift teils gesetzte, teils gestochene Gesangbuch, das jahrzehntelang als liturgisches Reglement für die täglichen Gottesdienste im „Schloß vor Husum“ diente, von ihrer Mutter als Geschenk erhielt. (Vgl. Kadelbach 1983; 1997)
Es kann als wahrscheinlich gelten, dass diese seltene hymnologische Quelle auch dann noch in den Hofgottesdiensten in der Schloßkirche oder zumindest in den Privatgemächern in Husum wie auch in Güstrow eine Rolle spielte, als Johann Christoph Jauch dort seine ersten Erfahrungen als Prediger machte - also z.B. 1695, in dem Jahr, in dem er von Rostock aus „eben auf der Reise nach Kiel, Gottorf, Husum und andern Holsteinischen Oertern begriffen war“ - just, als sein künftiger Lüneburger Patron Ludolph von Stöterogge sein berufliches Schicksal in eine unverhoffte Richtung zu wenden begann.
Es ist nicht auszuschließen, dass Johann Christoph Jauch, Johann Nikolaus Bach, Georg Böhm sowie Mitglieder des sich später als „Liederfreunde“ empfindenden und sich auch so nennenden informellen Zirkels 1694f die auch aus heutiger theologischer Sicht als spektakulär zu betrachtenden Oratorienaufführungen Johann Lippoldts in der Collegiumskirche Jena miterlebt und sogar an ihnen mitgewirkt haben könnten. (Vgl. Rathey 2011b)
1711 publizierte der Schmalkaldener Pfarrer und Hymnologe Johann Avenarius (einer der wortführenden „Liederfreunde“) eine beiläufige Bemerkung, wonach sein Jenaer Mitstudent und “Stuben Geselle” Jauch jeden Morgen und jeden Abend den Choral “Ach, was soll ich Sünder machen” gesungen habe - also eines jener im privaten Bereich geschätzten Lieder, über das Johann Sebastian Bach während oder nach seiner Lüneburger Zeit (im Vorfeld seiner Studienreise 1705/06 von Arnstadt über Lüneburg und Hamburg nach Lübeck?) eine Folge von Variationen in ihre heute bekannte Form (BWV 770) brachte, deren Stilelemente Georg Böhm als Anregungen für seine eigenen Umsetzungen dieser Gattung gedient haben könnten.
Beobachtung am Rande: Jede der sieben Strophen dieses Liedes (Johann Flittner, geb. 1618 im thüringischen Suhl, gest. 1678 in Stralsund; Studium in Jena, Leipzig und Rostock) endet mit der Zeile: „Meinen Jesum lass ich nicht“.
„Als ich anno 1690 zu Jehna studirte / hatte ich einen recht frommen und exemplarischen [also vorbildlichen] Stuben Gesellen / welcher jetzo in dem Chur-Fürstenthum Hannover ein beliebter Prediger ist / der sunge dieses Lied Morgens und Abends / hielte auch dafür / wenn er des Morgens dieses Lied nicht angestimmet / er sey den gantzen Tag in seinen studiis unglücklich / sünge er aber solches des Abends nicht / so wäre er die gantze Nacht unruhig / und nennet er es nicht anders als sein Asylum cum auxilio, das ist mein Lied / das mir Sicherheit und Hülffe in allen Verrichtungen verschaffet.“
In der Woche vor dem 1. Sonntag nach Trinitatis 1725 (dem Termin für den Beginn des neuen Schuljahres an der Thomana und somit eines möglich erscheinenden neuen Kantatenprojekts) traf Bach mit dem nun zum Superintendenten avancierten Avenarius anlässlich einer Orgelweihe in Gera zusammen. Die Annahme erscheint reizvoll, dass bei dieser Begegnung eine nachträgliche Vervollständigung - vielleicht gar eine nachfolgende Textpublikation - des abgebrochenen Choralkantantenjahrgangs ein Thema gewesen sein könnte, obwohl Avenarius nicht als Verfasser von madrigalischen Dichtungen bekannt geworden ist. (Vgl. Maul 2004a, der die irrtümliche Datierung in DOK II korrigert.)
Einen ersten Kontakt zur Familie Avenarius dürfte Bach bereits in Ohrdruf aufgenommen haben, wo Johann Martin, ein Neffe des späteren Superintendenten, von 1697 bis 1700 als Chorpräfekt des dort von Bach besuchten Lyzeums fungierte. (Vgl. Kraft 1956)
Jauchs Neuordnung und Erweiterung der Elmenhorst-Lieder lässt sich vor dem Hintergrund der hymnologischen Aktivitäten seiner Jenaischen Zeitgenossen interpretieren, die um 1700 nach dem Tod des dortigen Superintendenten Georg Goetze (1633 -1699, nicht identisch mit dem fast gleichnamigen, gleichwohl wesensverwandten Lübecker Superintendenten und Hymnologen; 1667- 1728) mit einer Edition von dessen, 1692 (nach dem Vorbild Johann Benedict Carpzovs im nahen Leipzig) in der Stadtkirche St. Michael gehaltenen Liedpredigten einsetzten, die Jauch in Jena Sonntag für Sonntag - vielleicht gar als dessen ständiger Tischgast? - miterlebt haben muss. (Privates Digitalisat der posthumen Ausgabe, deren Haupttext mit [I]n [N]omine [J]esu beginnt, im Besitz des Verfassers.)
Die Parentation für den 1699 - im selben Jahr wie Carpzov - gestorbenen Goetze, der von Zeitgenossen wegen seiner Predigtkunst als „Jenaischer Chrysostomos“ (Goldmund) titutliert wurde, stammte übrigens von Bachs spätererem Weimarer Hauptlibrettisten Salomon Franck.
Die in Güstrow erprobte, in Jena und Rostock akademisch vertiefte, in Lüneburg praktisch perfektionierte Predigtkunst wird gerühmt im Glückwunschgedicht M.C. Brandenburgs anlässlich der Ernennung seines Ziehvaters Jauch zum Lüneburger Superintendenten 1714:
Ein Lehrer, welchen GOtt vor vielen andern liebet
Dieweil Er Ihm sein Hertz in stiller Furcht ergiebet,
Nicht aber Heuchlerisch dem Pharisäer gleicht;
Der seine Gottesfurcht mit Wissenschafft vereinet.
Und durch Beredsamkeit ein Felsen-Hertz erweicht
Aus dem Chrysostomus mit Krafft zu reden scheinet.
(Zum Stichwort „Felsenherz“ vgl. Schwieger 1659, Keiser/Hunold 1704/06, Brockes 1715 und BWV 181).
Jauch immatrikulierte sich (ohne erneute Deposition) am selben Tag (26.4.1689) an der Universität Jena wie Johann Anastasius Freylinghausen, der später ungleich breitenwirksamere, pietistisch orientierte Gegenspieler der orthodoxen Liederfreunde, der von seinem erwünschten Tischherrn Goetze trotz Vorlage eines Empfehlungsschreibens (zugunsten wessen?) nach eigenen Worten noch am selben Tag abgewiesen wurde.
In dem am 1. Juli 1722 datierten Vorwort einer „Melodiae Sacratissimae“ betitelten Publikation des in Celle amtierenden Garnisonpredigers Christian David Danielis - deren Haupttext unter der Invocatio [I]n [N]omine [J]esu [A]men steht (vgl. BWV 16) - offenbart Jauch nicht nur seine profunde, mit regionalspezifischen, vorwiegend norddeutschen, teils singulären Beispielen belegte Kenntnis der Geschichte der musikalischen Psalmbereimungen, zu denen Danielis eine bemerkenswerte Variante beitrug.
Der ehemalige Lüneburger Johanneumschüler Danielis hatte versucht, unter möglichst genauer Beibehaltung des „bei den lieben Einfältigen beliebten“ Lutherschen Wortlauts alle 150 Psalmen des Alten Testaments in die metrischen Schemata der damals „gebräuchlichsten” protestantischen Kirchenlieder zu zwingen und einen Plan beigefügt, sie in dieser Form (zu jeweils einer oder mehreren passenden Melodien) über das Kirchenjahr verteilt im Rahmen sonntäglicher häuslicher Andachten zu singen. (Vgl. eine weitere, 1728 bei Förster in Hannover erschienene Auflage, deren heutige Titelaufnahmen unzutreffenderweise Jauch statt Danielis als Gesamt-Autor nennen. Vielleicht versprach sich der Verleger der Zweitauflage von einem bekannteren Namen in Verbindung mit einem konsequent eingedeutschten Titel einen besseren Verkaufserfolg?)
Jauch kommentiert Danielis’ Versuch durchaus kritisch und lässt darüber hinaus erkennen, spätestens zu diesem Zeitpunkt (Mitte 1722) selbst Erfahrungen mit der (wie er zugibt, poetologisch nicht immer einfachen) Übertragung von Texten Luthers in eine andere, musiziertaugliche Form gemacht zu haben:
„… hat er [Danielis] lieber den hohen Poetischen Geist andern [wem?] überlassen / und sich denen meisten [den „lieben Einfältigen“] accomodiren wollen: dahero um so viel mehr Lob verdienet / als es denen in dergleichen Arbeit Erfahrnen [den „andern“, auf jeden Fall aber auch ihm selbst: Jauch] bekandt / was es für eine Arbeit sey / wenn man mit Beybehaltung der eigentlichen Wörter eine solche Ubersetzung unter Händen hat / und dieselbe in ein gewisses Genus Carminum bringen will.“
Mit dieser Stellungnahme rekurriert er zugleich - in einem für ihn sicher ungewohnten öffentlichen Diskurs - auf die Formulierung seines Hamburger Kollegen und ehemaligen Mitbewerbers (1715) Erdmann Neumeister, mit der dieser 1704 seine eigene Umsetzung lutheresker Bibelprosa in - zumindest formal - hochmoderne, mehr dem „hohen Poetischen Geist“ als dem altbewährten Verständnishorizont der „lieben Einfältigen“ verpflichtete Kantatentexte umschrieben hatte:
„… so siehet eine Cantata nicht anders aus, als ein Stück aus einer Opera, von Stylo Recitativo und Arien zusammengesetzt. Wer nun [wie Ich: Neumeister] weiß, was zu beiden erfordert wird, dem wird solches Genus carminum zur Ausarbeitung nicht schwer fallen.“
Damit thematisierte Jauch den Kern der Aufgabe, vor der der Autor der Texte für Johann Sebastian Bachs Choralkantaten bald darauf, anlässlich des vom ehemaligen Johanneum-Schüler, Leipziger Theologiestudenten und nunmehrigem Hannoverschen Kreuzkirchen-Pfarrers Peter Busch öffentlich thematisierten, „nicht unfüglich zu nennenden … Annulus Jubilaeus“ 1724/25 stehen sollte: Die Übertragung von Texten Luthers und weiterer kanonisierter Liederdichter in eine bestimmte musizierbare Gestalt („Genus carminum“) - und das konnte Anfang der 1720er Jahre nur bedeuten: in eine regulierte Abfolge von unverändert zitierten Rahmenstrophen und regelgerechten - besser gesagt: regelüberwindenden - Umwandlungen in zeitgemäß formulierte Rezitative und Arien.
Somit wählte Jauch einen alternativen Ansatz: Während Danielis die ursprünglich frei fließenden, ab 1524/25 zum Teil auch in Liedform versifizierten Psalmübersetzungen Luthers in strenge Reimschemata mit jeweils identischer Zeilenzahl zu pressen versuchte, ging sein poetologischer Mentor Jauch 1724 einen radikal umgekehrten Weg, nämlich den der Umwandlung von Strophenliedern in moderne, in den Rezitativen kaum noch regelgebundene Textformen, die freilich für gänzlich andere, erheblich anspruchsvollere musikalische Gestaltungsweisen bestimmt sein sollten.
Da der Weiterentwicklung der von Johann Sebastian Bach in seinen Weimarer Jahren - auf der Basis von Texten des ihm halbamtlich verordneten Salomon Franck - zu einer frühen Blüte geführten, madrigalesken Kantatentextform mit einer schematisch abgewickelten Verwendung von Material (wie z.B. bei Danielis oder den Kantaten „per omnes versus“ zu finden ist) nicht gedient war, stand der Autor vor einer völlig neuen theologischen und poetologischen Herausforderung - die er im genannten Vorwort (vorausschauend oder schon in statu nascendi?) zwischen den Zeilen reflektierte.
Als Randbeobachtung soll nicht unerwähnt bleiben, dass Danielis an das Ende seines Elaborats (als augenscheinlich produktionstechnisch bedingten Lückenfüller - oder vielleicht doch auch als wahre Herzensergießung?) ein eigenes Passionslied anfügte, dessen erste Strophe jene (grammatisch ankreidbar formulierte, da der musikalischen Metrik gehorchende) Anspielung an Jesaia 35,7 enthält, die wortgleich auch im Exordium von BWV 244b erscheint: „… als wie ein Lamm…“.)
Erst durch J.W. von Goethe wurde eine derartige Regelwidrigkeit endgültig zum legitimen Bestandtteil der deutschen Dichtkunst erhoben („… da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug, als …).
Es bleibt ferner zu untersuchen, in wie weit die nach Wolff (2020) als Proto-Choralkantaten und die von Petzoldt (1991) als „uneigentliche Choralkantaten” interpretierbaren Kompositionen der Jahre 1723/1724 als Entwicklungsphasen auf dem gemeinsamen Weg von Autor und Komponist aufgefasst werden können - allen voran: “O Ewigkeit, du Donnerwort“ BWV 60.
Eine genauere Analyse des von Krummacher (2018) thematisierten zögerlichen Umgangs von - wohl schon in den Textvorlagen nicht eindeutig deklariertem - Da Capo in diesem speziellen Teil des Kantatenkorpus könnte hierzu als methodischer Einstieg dienen.
Nicht nur war der erste Sammeldruck des den jeweiligen Titel bestimmenden Chorals von BWV 60 und von BWV 20 („O Ewigkeit, du Donnerwort“, Johann Rist, Lüneburg: Stern, 1652) sämtlichen namentlich gelisteten Führungsmitgliedern des ev. Michaelis-Klosters gewidmet. Auch der Text des Schlußchorals von BWV 60 („Es ist genug“) stammte von einer Person mit Lüneburger Lebensbezug, nämlich von dem 1672 gestorbenen Michaelis-Pastor Franz Joachim Burmeister - Poeta Laureata Caesareus und Mitglied einer traditionsreichen Lüneburger Musikerfamilie sowie unter dem Dichternamen „Sylvander“ des von Rist 1656 gegründeten und bis 1667 geleiteten, nicht nur sprachpflegerisch tätigen, sondern auch musikinteressierten Elbschwanen-Ordens.
Hat hier der Autor einen gleich zweifachen Anlauf unternommen, sein Material und die daraus zunächst zu erhoffenden, sodann im fernen Leipzig tatsächlich entstandenen Kompositionen auch einer - formell zwar konkurrierenden - Institution vor seiner Haustür anzudienen (dem seit der Aera von Spörcken nachhaltig geförderten Mettenchor und seinen instrumentalen Adjuvanten), deren aufführungspraktische Kompetenzen nach allem, was bekannt ist, deutlich über denjenigen des von ihm selbst als Inspektor betreuten wie als Prediger erlebten (eher wohl erlittenen) Chorus Symphoniacus an St. Johannis standen?
Freilich hätte er sich und seine Hörerschaft damit um den Genuss seiner zur „Prime-Time“ am späten Sonntagmittag vorgetragenen Auslegungen auf der Kanzel von St. Johannis gebracht - in Form von Liedpredigten, deren Gestaltungsprinzipien ihm aus seinen Jenaer Jahren bei Georg Goetze noch wohlbekannt sein mussten.
Eine - wo auch immer anzusiedelnde - Lüneburger Zweitverwertung (oder steckte gar das Projekt einer Erstverwertung mit lokalen Produzenten dahinter?) hätte auf jeden Fall aber nur mit zwölfmonatiger Verspätung beginnen können - beispielsweise zum 1. Advent 1725 - denn bekanntlich war Bachs Leipziger Aufführungskalender gegenüber dem offiziellen ev. Kirchenjahr „verdreht. (Vgl. die frappierend innovativen und instruktiven Grafiken bei Gardiner 2013). Etwas Anderes hätte Bachs extrem knapp getakteter Produktionszyklus nicht zugelassen. Wie dem auch sei: eine Weiterführung des Gemeinschaftsprojekts aus den hier gemutmaßten Gründen belässt solche Überlegungen für immer im Bereich des Wunschdenkens.
Bekräftigt wird diese abschließende Bewertung in gewisser Weise durch die unerfreulich uneindeutige Mitteilung des 1735 geborenen Michaelis-Archivars Albrecht Ludwig Gebhardi, die sich streng genommen nur auf dessen lokalen Erlebnishorizont ab ca. 1745 beziehen kann, möglicherweise aber auf ältere - (heute mehr denn je vielleicht eruierbare?) Realien, wonach zwar regelmäßig Texte für jährliche Passionen und sonntägliche Kantaten in Lüneburg gedruckt wurden - diese aber, wie die Musik, dort nicht entstanden sind:
„Der musikalische Chor führte unter der direction des Cantors gebundene oder ungebundene Singstücke am Charfreytage auf, wovon der Text in Octav abgedruckt ward, so wie jeder[!] Text der sonteglichen Kirchen musik auf ein oder zwei blättern. Sowohl die Composition als der Text waren von auswärtigen verfertigt. Auch ward ein Stuck nach ein paar Jahren wieder gebraucht.“ (Vgl. Walter 1967, 159)
Der erwähnte Psalmenbearbeiter Danielis war musikalisch insofern vorgebildet, als er 1695/96 (also beim Amtsantritt Jauchs und vier Jahre vor Bachs Intermezzo in dieser Institution) als Bassist im Mettenchor der Michaeliskirche gesungen hatte, bevor er im Juni 1697 zum Studium nach Helmstedt und 1702 an die Universität Jena wechselte. Wie bald darauf auch Bach, wird er dem damaligen, frisch ernannten Lamberti-Prediger Jauch bei den extensiven, systematischen Besingungen der Lüneburger Stadtviertel im Winterhalbjahr sowie bei weiteren Auftritten, etwa anlässlich von Beisetzungen, unter Augen und Ohren gekommen sein.
Die Publikation Danielis’ und das Vorwort Jauchs wurden (es bleibt zu fragen: durch wen?) nach einer Vorankündigung im Katalog zur Michaelismesse 1722 (Erscheinungsorte demnach: Celle und Leipzig; Bezugsmöglichkeiten laut Titel „beym Autore und bey Christ. Jul. Hoffmann, Buchdr. u. Buchhändl.“) in einer am 19.1.1723 erschienenen Rezension im führenden überregionalen Blatt der Zeit, dem “Holsteinischen Correspondenten”, kurz und kritisch (wenn nicht gar, durch Verwendung des Pejorativums „Flickwörter“ und dem Vorwurf einer Abweichung „von den Worten der Schrifft“, letzlich durch die finale Andeutung „bald andere Umstände“) abwertend besprochen.
Bei Würdigung des Gesamtkorpus solcher seltenen Beiträge in der damaligen Tagespresse bleibt der Eindruck, es könnte sich hier um eine bewusste Replik gehandelt haben, veranlasst - oder zumindest wohlwollend beachtet - oder gar verfassst durch den Urheber der ursprünglichen Anmerkung von 1704: Erdmann Neumeister - sofern man diesem die durchaus regelkonforme Umformung des lateinischen Werktitels sowie einige norddeutsche Regionalismen und die kaum verdeckte Sottise im letzten Halbsatz zurechnen möchte.
„Zelle. Der hiesige Guarnison-Prediger, Herr David Christ. Danielis, hat neulich heraus gegeben Melodias sacratissimas, d.i. die Heil. Psalmen Davids etc. auf die aller-bekannteste Melodeyen der Evangelisch-Lutherischen Kirchen-Gesänge in Versen verfasset. Er hält sich zwar ziemlich an den Worten der Schrifft; doch hat ihn auch öffters das Metrum gezwungen, davon abzuweichen. Der Herr Superintendens Jauch zu Lüneburg, der eine Vorrede dazu gemacht, nennet sie recht wohlgerathen, gesteht aber auch selbst, daß sie nicht gar zu fliessend. Und in der That ist diese Paraphrasis nicht allein hart, sondern auch voller Flickwörter, dazu bald die Reime, bald andere Umstände mögen Anlaß gegeben haben. Dem Wercke ist sonst ein Anhang von einigen Gebeten, ingleichen ein Paßions-Lied aus Esaiae Cap. 35 und endlich eine Anweisung auf alle Sonn- und Fest-Tage beygefüget, dafern man etwa diese Psalme zu seiner Privat-Andacht singen wolte.“
Es ist nicht auszuschließen, dass Bach in Köthen - bald nachdem er in den Berufungsprozess für das Leipziger Kantorat involviert worden war - von dieser Zeitungsnotiz Kenntnis erlangte und ihm somit der Name des einstigen Lüneburger Pfarrers und nunmehrigen Superintendenten in Erinnerung gebracht wurde - in einer Situation, wo sich ein verlässlich zu bedienender Bedarf für theologisch qualifizierte, predigttaugliche Kantaten- und Passionstexte abzeichnete.
Der zeitlebens zwar engagiert, wenig ambitioniert wirkende Jauch hatte bei der Suche Bachs und seiner Mitverantwortlichen nach einem weltanschaulich als untadelhaft, landsmannschaftlich als bodenständig, poetologisch durchaus als flexibel vermittelbarem Librettisten einen Vorsprung vor dem drei Jahrzehnte jüngeren, vigilanten Sachsen Christian Friedrich Henrici, der ab 1. Advent 1724 in seinen „Erbaulichen Gedancken“ einen sukzessive entstehenden Jahrgang von (post sermonis, nämlich „Sonnabends und Sonntags nach geendigter Vesper“ aufgeschriebenen), zunächst in Form von wöchentlich 1/2 Druckbögen angekündigten, Ende 1725 dann (mangels Erfolg beim Einzelverkauf?) als Sammeldruck auf den Markt gebrachten Meditationen auch vollumfänglich vorlegen sollte, die aufgrund ihrer monotonen Form und ihrer Länge als absolut unvertonbar angesehen werden mussten - und die im übrigen (mit Ausnahme des bei genauester drucktechnischer Betrachtung als Fremdkörper wirkenden „Oratoriums“ für Gründonnerstag / Karfreitag?) auch keineswegs als „Texte zur Music“ beabsichtigt waren.
Auch Henricis jeweils beigegebene Kontrafakturen bekannter Kirchenlieder stellen ein höchst interessantes Parallelprojekt zu Bachs Choralkantatentexten dar und sind - wie die Sammlung insgesamt - auf eventuelle Querbeziehungen hin zu überprüfen - obwohl die Intention des Verfassers wohl darin bestand, strophenweise handhabbares Füllmaterial bei der optimalen Ausnutzung des Druckpapiers zu nutzen - ein weiteres Argument für die Richtigkeit der Annahme einer ursprüngliche Intention in Form von Einzeldrucken.
Mit Johann Christoph Jauch konnte Bach bei seiner - vom unbarmherzig getakteten Aufführungskalender diktierten - kompositorischen Akkulturation in Leipzig auf einen theologischen Gewährsmann setzen, der sich zwar sprachstilistisch nur sehr subtil und im Verlauf eines durchaus rekonstruierbaren Entwicklungsprozesses an die eine Tagesreise von Lüneburg residierende norddeutsche Avantgarde angenähert hatte - also an Barthold Hinrich Brockes und seinen Kreis (gewiss auch unter dem Einfluss seiner eigenen Schüler Michael Christoph Brandenburg, Matthias Daniel Behm und Joachim Christian Heini, aber auch ephemerer Randfiguren wie Hunold/Menantes), der aber konfessionell deutlich unproblematischer erscheinen musste als der (nach heutiger Lesart wegen Häresie, tatsächlichnaber wohl wegen temporärer individualspychologischer Probleme) seit 1697 amtsenthobene, zeitweise unter Hausarrest stehende, sodann unter ansatzweise ermittelbaren Bedingungen geduldete und besoldete, Bach bis Frühsommer 1723 noch nicht persönlich begegnete Conrector emeritus Johann Andreas Stübel - von dem kaum den intellektuellen und gesellschaftlichen Kinderschuhen entwachsenen Leipziger Enfant terrible Christian Friedrich Henrici ganz zu schweigen.
Stübel, der zeitweise mit einem - von ihm selbst dokumentierten - Publikationsverbot belegt wurde, schildert die auslösenden Ereignisse und die absehbaren Folgen für sein sodann sonderbar schmal gewordenes publizistisches Oeuvre ab ca. 1700 (bei den, z.B. bei „worldcat.org“ herumgeisternden, anonymen „Aufgefangenen Brieffen“ dürfte es sich um einige der von Bircher B 9228-9239 unreflektiert übernommene Fehlzuschreibungen nach Holzmann-Bohatta I/7897 handeln) in seinem 1698 gedruckten Schriftenkatalog, der mit der Invocatio [J]n [J]esu [C]hristi [N]amen [A]men anhebt. Und zwar so:
„Auffs Jahr 1697, hatte ich mir vorgenommen / gar viele Schrifften zu publiciren; Homo proponit, Deus disponit. Ich gerieht damals im Februario in eine sonderbare Geistliche Anfechtung / nach dessen glücklicher Ueberwindung und darauff erfolgten hart ausgestandenen halbjährigen häußlichen Verwachung ich nur das wenigste ans Licht bringen können“.
Was Henrici betrifft, so hatte sich dieser - nicht nur durch seine ständigen, gerichtsnotorischen Beißereien mit seinem beinahe existenzgefährdend zurückschlagenden literaturpolitischen Lieblingsgegner Gottsched (reichhaltiges Rohmaterial bei Otto 2007), sondern auch in den von Woche zu Woche parallel zu den Aufführungen der Choralkantaten entstandenen und publizierten „Erbaulichen Gedancken“ - durch kaum verklausulierte (als wahrhaftige Confessio intendierte oder nur in ironischer Absicht fingierte?) Stellungnahmen im offiziell längst terminierten „Terministischen Streit“ bis auf weiteres auch theologisch als Emporen-untauglich disqualifiziert.
Dem wiederholt - meist implizit und somit unreflektiert - vorgebrachten Argument, Bach müsse (alle?) seine bislang anonymen „Leipziger“ Texte selbstverständlich in Loco und in enger persönlicher Abstimmung von einem wenigstens zeitweise dort oder in der allernächsten Umgebung lebenden studentischen Dichter erhalten haben (so sinngemäß jüngst noch Koska 2023a; Blanken 2023), ist entgegenzuhalten: Ein zwischen Bach und Jauch angewendetes Verfahren der Lieferung von „Paketen“ alle vier bis acht Wochen (man mag sie plakativ „Sixpacks“ nennen) bot zwar keine Möglichkeiten für komplexe mündliche Rückfragen, etwa zu deklamatorischen Details, metrischen Finessen oder Steilvorlagen für onomatopoetische Motivik (wie in BWV 127). Aber vielleicht haben die Beteiligten sich implizit auf einen externen „Lektor“verlassen, z.B. einen der in Lüneburg lebenden, mit solchem Sachverstand bestens ausgestatteten Kantatenkomponisten wie Georg Flor bzw. Georg Böhm, deren Kompetenzen Bach bei seinem Aufenthalt im Jahr 1700 (und auch bei späteren Durchreisen) buchstäblich erleben konnte?
Kritische Zwischenfrage: Welcher genialische Leipziger oder Wittenberger oder Jenaer, oder sonstwo in einer Butze hausende, finanziell darbende SS. Theol. Stud. hätte mit einer mehrjährigen Predigterfahrung sowie verlässlicher Produktionsdisziplin dienen können, wie sie für die streng getakteten, approbationsfähigen Textlieferungen ab Trinitatis 1724 unterstellt werden müssen? Oder gar mit einem, dem Jubiläumsjahr 1724/25 angemessenen, hymnologischem Konzept?
Hinsichtlich der theologischen Integrität der Texte konnte man sich auf die überregionale Reputation Jauchs verlassen, der zudem als Lüneburger Superintendent mit der verbindlichen Vorzensur der dort erscheinenden Druckprodukte (nicht nur der Müller-Predigten) bestens betraut war. Prinzipielle Probleme mit dem (wenn es denn nur ein Einziger war?) Leipziger Zensor (nach allem, was bekannt ist: Salomon Deyling) dürfte es also wohl nicht gegeben haben. (Vgl. Wricke 1973) Gleichwohl stellten die Leipziger Drucker regelmäßig einige Pfennig-Beträge „pro Censura“ in Rechnung. (Modern gelesen: eine Art „Doppelbesteuerung“ …)
Und was die Abstimmung über eine generelle Grobstruktur betrifft: für Bachs zweiten Kantatenjahrgang dürfte die Zuordnung der feststehenden Perikopen zu jeweils passenden Chorälen aus einem weitgehend anerkannten Grundrepertoire und sodann eine vorausschauende Abstimmung über Art, Anzahl und Reihenfolge der Binnensätze einer jeden Kantate nicht nur ausgereicht, sondern für den Komponisten hinreichende Freiheitsgrade ermöglicht haben. Für derartige Schemata gibt es zahlreiche gedruckte Beispiele aus der Feder der „Lieder-Freunde“ und ihrer Vorgänger und Zeitgenossen - denen es freilich (abgesehen von offenkundigen Allgemeinplätzen zu den thematisch vorbestimmten Hochfesten Weihnachten, Ostern, Pfingsten etc.) ansonsten an Kongruenz mangelt.
Der Umstand, dass Jauchs Brüder Johann Daniel und Franz Georg sowie sein Schwager Johann Christoph Naumann herausgehobene Positionen am Dresdener und am Warschauer Hof August des Starken und seines Nachfolgers innehatten, mag - wie auch seine bereits erwähnte, spätestens 1719 öffentlich bekannt gewordene, zeitweilige seelsorgerische Betreuung von dessen Gemahlin - seine allseitige Akzeptanz im komplexen Leipziger Politikgeflecht (vgl. Siegele 1985ff) eher gefördert als behindert haben.
Ob sich in den Kantatentexten von Anfang 1725 erste Spuren einer unterschwelligen Auseinandersetzung mit dem „Thorner Blutgericht“ finden lassen - einem von Jesuiten initiierten, am 7. Dezember 1724 an der lutherischen bürgerlichen Elite der polnischen Stadt Thorn blutig exekutierten, staatlich inszenierten religiösen Racheakt - an dessen militärischer Durchsetzung Franz Georg Jauch beteiligt war und das im protestantischen Europa nachhaltige Empörung auslöste (z.B. in den 1725 gedruckten „acht Catechismus-Predigten … nebst beygefügten Anmerckungen über die letzte Lieder-Andacht der getödteten…“ des Lübecker Superintendenten, Hymnologen und Lieder-Freunds Georg Heinrich Goetze), ist aufgrund der engen zeitlichen Abfolgen eher unwahrscheinlich.
Am 10. Mai 1855 - also etwa 130 Jahre nach dem Tod ihres ursprünglichen Textdichters - wurde die Matthäus-Passion Johann Sebastian Bachs auch in Lüneburg unter Benutzung einer „durch königliche Huld“ dem Johanneum geschenkten Partitur und geleitet von dem ab 1836 in Leipzig lernenden Musikpaedagogen, 1842 zum Johannis-Organisten berufenen Louis Anger (vgl. DOK VI, B78) erstmals aufgeführt, in Jauchs langjähriger Wirkungstätte als Prediger, Seelsorger, Superintendent und Schulinspektor, an dem Ort, an dem seine sterblichen Überreste im Chorraum vis à vis der jahrzehntelang von Georg Böhm (und einst wohl auch vom jungen Bach) gespielten Orgel seit dem 6. Februar 1725 ruhten - wohl bis zur Auflassung der innerkirchlichen Grabstätten im 19. Jahrhundert. Anger dürfte mit einiger Sicherheit Zeitzeuge (vielleicht gar Mitwirkender?) der epochemachenden Leipziger Bearbeitung und Aufführung der Passionsmusik durch Felix Mendelssohn Bartholdy im Jahr 1841 gewesen sein.
Die aus rezeptionsgeschichtlicher Sicht durchaus erhellende Rezension dieser Aufführung in Ausgabe 3/1855 der Niederrheinischen Musikzeitung (Geck 1967: deest) stellt die frühest nachweisbare gemeinsame Erwähnung der Stichworte „Bach“, „Matthäus-Passion“ und „Lüneburg“ dar.
Bemerkenswert ist der vom Rezensenten, einem gewissen „J.“ wiedergegebene erste Eindruck:
„Es war nicht anders zu erwarten, als dass ein in seinen Ausdrucksformen unserem Zeitgeschmacke zu fern liegendes und dazu in seiner Ausführung so schwieriges Werk zuerst lau oder gar mit Abneigung aufgenommen wurde“.
Hinter dem Kürzel „J.“ verbirgt sich der Johanneums-Rektor Wilhelm Christian Junghans (1803-1886), Urheber des 1870 erschienenen ersten wissenschaftlich fundierten (da im brieflichen Austausch mit dem legendären Bach-Biographen P. Spitta entstandenen), zwar nicht fehlerfreien, aber bis heute respektvoll rezipierten Beitrags zu J.S. Bachs Lüneburger Jahren.
Der Verfasser erinnert sich gerne daran, jenes ferne Ereignis während einer am Karfreitag (30.3.2018) mit lokalen Kräften aufgeführten Darbietung, unter Mitverfolgung auch der exakt bemessenen Blankoseiten seiner digital annotierten Version des Agricola-Torsos P 26 in der ansonsten menschenleeren, stockdunklen, vom Namensgeber König Georg I. von Großbritannien und Kurfürst von Hannover wohl nie betretenen „Fürstenloge“ direkt unter der imposanten Renaissanceorgel von St. Johannis näherungsweise nachempfunden zu haben - im Bewusstsein, dass ca. 100 Schritte entfernt jenes Gebäude lokalisiert ist, in welchem Ende 1724, Anfang 1725 ein nicht unbedeutender Teil der zugrunde liegenden „Poesia“ entstand. Noch einmal 50 Schritte weiter entfernt wurden fast ein Jahrhundert lang die Passionspredigten Heinrich Müllers immer wieder neu gesetzt, gedruckt und verkauft.
Ein weiterer Besuch des Verfassers einer Aufführung von BWV 244 u.L.v. KMD Dr. Ulf Wellner fand am Karfreitag, (18.4.2025) statt. („Fürstenloge“, Reihe 1, Platz 1). Chronologisch betrachtet 300 Jahre nach jenem Termin, für den J.S. Bach eine Uraufführung seiner Matthäuspassion als integralem Bestandteil seines Choralkantaten-Zyklus geplant hatte.
Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle die Beobachtung bleiben, dass es sich bei einem der instrumental angedeuteten Choralzitate im Eingangschor der Kantate BWV 127 („Christe du Lamm Gottes“; zum 11.2.1725) und bei dem Anfang 1725 zunächst wohl nur instrumental aufgeschriebenen Cantus firmus „O Lamm Gottes unschuldig“ im Exordium von BWV 244b um die beiden durch eine zeitgenössische Quelle dokumentierten Sterbechoräle Heinrich Müllers handelt.
Zum einzigartigen musikalischen Selbstzitat in BWV 127/4 aus BWV 244b/27b vergleiche man in erster Näherung Whittaker (II/1959), Smend (VI/1966), Chafe (1982) und Gardiner (2013) - sowie das beredte Schweigen fast aller übrigen Kommentatoren.
Kaum 100 Treppenstufen höher auf der aus Backsteinen gewundenen „Himmelsleiter“ (die der Verfasser 1991 im Rahmen einer akademischen Orgelexkursion auf beinahe lebensgefährliche Weise ersteigen durfte) erklangen während der Beisetzung Jauchs am 6. Februar 1725 im Chorraum der St. Johannis-Kirche auch die auf den heutigen Nominalton h° lautende Apostelglocke (gegossen von Ghert Klinghe im Jahr 1436) und die auf cis’ lautende Sonntagsglocke.
Für den Umguß der Sonntagsglocke durch den Lüneburger Gießer Johann Zieger hatte der Superintendent Jauch 1718 eine zweieinhalbstrophige, sprachlich für jene Zeit durchaus modern wirkende Glockenzier verfasst, die in ihrem Mittelteil die Hörer zum Bedenken der eigenen Todesstunde aufruft. Man betrachte und behöre den - nur in der Originalstimme, nicht in der Partitur - von Bach selbst nachträglich als „pizzikato“ bezeichneten, somit vielleicht als Pentimento einzuschätzenden - komplementärrythmisch tiefoktavierenden Instrumentalbass zu Beginn von BWV 127/3 und die ebenfalls onomatopoetisch nachgebildeten „Sterbeglocken“ im Mittelteil dieser Arie.
Der heute noch les- und tastbare Text für die Sonntagsglocke von St. Johannis, verfasst von „M.I.C.J.“ = [M]agister [I]ohann [C]hristoph [J]auch, lautet in einer zeitgenössischen Umschrift (oder Wiedergabe einer Urschrift?):
Ich läute als die Sonntags-Glocke
Zur Kirchen in das GOttes-Hauß,
Womit ich stets zur Buße locke
Die gehn hinein und auch heraus.
Auch läute ich offt zu dem Grabe
Dahin ein Christe wird gebracht.
GOtt geb, daß es den Nutzen habe,
Daß man sein letztes End betracht.
So hört man nicht vergeblich an,
Was Glocken-Läuten lehren kann.
(Bertram 1719, nicht paginierter Nachsatz „Addendum ad. p. 724 seq.“ Die gegossene Form ist ortho- und typographisch deutlich antiquierter; vgl. Wiesenfeldt 2011; Wiesenfeldt 2014.)
Die ebenfalls noch zu Lebzeiten Jauchs 1723 durch (den zumindest temporär ortsansässigen) Paul Voß umgegossene „Grosse Vossische Glocke“ der ehemaligen Lambertikirche (Jauchs erster Predigtstätte) wurde nach deren Auflassung 1850ff zur Nikolaikirche (seinem ehemaligen zweiten Dienstort) verbracht, wo sie die rechtswidrigen, da von einem illegitimen Regime verfügten Massen-Beschlagnahmen während des II. Weltkriegs nicht überstand. Leider ist der Inhalt der Aufschrift nicht überliefert, sondern nur eine Kurzbeschreibung der figürlichen Zier („Christus am Kreuz und die Schlange am Kreuz“) sowie der Durchmesser: 1713 mm, aus dem sich ein ungefährer Schlagton bei a0/b0 ableiten lässt. (Vgl. Wolf 1902).
Der Text der von Georg Böhm (laut Aktenlage allein erwerbsberechtigt für derartige Aufträge in St. Johannis) vertonten Trauerkantate zur Beisetzung Jauchs am Dienstag, 6.2.1725, stammt von Michael Christoph Brandenburg (1694-1766) - auch er ein Schüler des Johanneums - der von Jauch nach einer Brandkatastrophe in seiner Geburtsstadt Boizenburg (Oktober 1709) in die Familie aufgenommen und in seinen literarischen Ambitionen nachhaltig gefördert worden war, wie der Zwanzigjährige anlässlich der Amtseinführung des Superintendenten am 23.2.1714 in einigen, um Wohlgeformtheit bemühten (unrein: „hören“ - „verehren“) Alexandrinern (von wem finanziert?) drucken ließ, darunter diese Zeilen:
Du hast es mir erlaubt mit Nutzen anzuhören
Worin ein Musen-Sohn sein Glücke finden kan
Und durch bemühten Fleiß die Pallas zu verehren.
Der Eingangssatz der 11 Jahre später von Brandenburg verfassten Trauermusik beginnt mit der Aufforderung:
„Kommt heran, ihr Zions-Hertzen!“
und legt somit Assoziationen zu BWV 244b/1 nahe
„Kommt ihr [Zions-]Töchter, helft mir klagen!“
und zur bereits erwähnten „Elmenhorst-Arie“ Nr. 12 aus dem Jahr 1700:
„Ihr Töchter Zion, gehet her / Mit Seufzen, Ächzen, Weheklagen“.
Brandenburg zählte zur einer neuen Generation von norddeutschen Poeten im Umkreis der Hamburger literarischen Größen Brockes und Weichmann, in dessen (Brandenburg gewidmetem) Band V der Anthologie „Poesie der Niedersachsen“ das erwähnte Epicedium 1738 erneut veröffentlicht wurde. Er gilt als enger Vertrauter des Dichters Christian Günther in dessen letzten, prekären Leipziger Lebensjahren und verfasste zwischen 1716 und 1750 - nicht ohne Konflikte mit der dortigen geistlichen Obrigkeit (J. Carpzov; offenbar aber nicht mit dessen Vorgänger bis 1728, dem ursprünglich „Jenaischen Lieder-Freund“ Georg Heinrich Goetze) - oratorische Texte für die Lübecker Abendmusiken. Die Annahme eines literarisch/biographischen Beziehungsdreiecks (Jauch/Goetze/Brandenburg) erscheint unter diesen Umständen plausibel.
Das Vorwort zu Brandenburgs Lübecker Oratorium „Gideon“ ist datiert „Lüneburg, 20.10.1716“ - auch der Haupt-Text entstand somit wohl in Jauchs Wohnung (Am Sande Nr. 27) - wenige Schritte zwischen St. Johannis und dem Herstellungsort von mindestens neun der bisher ermittelbaren Lüneburger Auflagen der Müller-Predigten. In der Vorrede entschuldigt sich Brandenburg übrigens für etwaige „Härtigkeiten der Poesie“, die durch sein Bemühen um weitgehende Beibehaltung „unserer teutschen Version“ in den biblischen Dialogen in Kauf zu nehmen waren.
Auch für Michael Christoph Brandenburg ist die Verwendung einer monogrammartigen Signatur überliefert, zeichnet er doch ein 1743 verfasstes Hochzeitsgedicht unter Anspielung auf den spätantiken Philosophen und Grammatiker Macrobius Ambrosius Theodosius mit dem Schäfernamen „MaCroBius“ = M.C.B. (Vgl. Kersten 2006).
Zu fragen bleibt, ob Brandenburg in Leipzig (wo er seit 1718 immatrikuliert war) auch dem 1720 dorthin aus Wittenberg übergesiedelten Jurastudenten und Mitglied des Wittenbergischen musikalischen Collegiums Christian Friedrich Henrici begegnet sein könnte. (Vgl. Erler 1909; Sehlke 2011) Letzterer könnte in Wittenberg (zwischen Mai 1719 und Mai 1720) seinerseits durchaus dem dort zwischen Oktober 1717 und Oktober 1720 eingeschriebenen Ludolph Friedrich Jauch über den Weg gelaufen sein. Mit den Worten seines Vaters an Valentin Ernst Löscher vom 3.11.1718 stellt sich dessen Aufenthalt in der Lutherstadt jedenfalls so dar:
„Es hat mir verwichenen Sommer mein Sohn gerühmet, und sich gefreuet, daß er das Glück gehabt Ew. HochEhrw. Magnif. auffzuwarten, und bin ich davor sehr obligiret daß Sie demselben dero hochgeneigteste admissionen haben wollen würdigen. recommendire Ihn ferner dero hohem Patrimonio. Er lieget Gott lob seinem Studiis in dem lieben Wittenberg noch mit fleiß ob, Gott wird dieselben ferner segnen!“
Brandenburg (und nicht etwa Jauch) war ab 1724 das einzige externe Mitglied der Hamburger Patriotischen Gesellschaft, für deren Organ „Der Patriot“ er unter einem Pseudonym Beiträge verfasste.
Der 1722-25 für den immerwährenden Freund der Familie Bach - Georg Philipp Telemann - (sicherlich nicht ohne wohlwollende Beobachtung durch seinen ehemaligen Tischherrn Jauch) in einzelnen Lieferungen bereitgestellte „Brandenburgische“ Kantatenjahrgang blieb im Dezember 1725 (sicher viel zu spät nach dem Beginn eines neuen regulären Kirchenjahres) unvollendet, da der Verfasser durch persönliche Befindlichkeiten und seine Tätigkeit als Prediger in Sterley (Herzogtum Lauenburg) ausgelastet war.
Zusammen mit dem ebenfalls aus arbeitsökonomischen Gründen nicht vollständig abgelieferten Jahrgang Erdmann Neumeisters für Telemann mag dies alles als eine bemerkenswerte zeitliche (und folgt man den hier vorgebrachten Argumenten: auch geographische) Koinzidenz zum Abbruch des Bachschen Choralkantatenjahrgangs betrachtet werden.
Der als etwa Zwanzigjähriger in „L.“ zu lokalisierende, aus Lauenburg stammende und somit nicht mit Georg Böhm verwandte Rostocker Theologiestudent Matthias Daniel Behm hatte 1715 in Frankfurt/Leipzig unter der Namensform „Behmenus“ eine - hernach kontrovers diskutierte - Sammlung von „Geist- und weltlichen Gedichten“ moderner, teils galanter Prägung veröffentlicht. Im Vorwort bezieht er sich zur Legitimierung seiner Nebentätigkeit nicht nur auf Erdmann Neumeister und andere einschlägig vorbelastete Hamburger geistliche Literaten, sondern auch auf die privaten schriftstellerischen Ambitionen seines lokalen „Patrons“, eines Superintendenten und „Haupt eines ehrwürdigen Ministerio“. Dieser „so gelehrte als geistreiche Theologus“ wird von Behm mit den Worten zitiert:
„Wenn ich Zeit übrig hätte, so wolte selbst Romanen, Opern und Comoedien schreiben, welche zwar von der heutigen Schreib-Art unterschieden, aber dennoch höchst-beliebt und erbaulich seyn solten.“
Da Behms gedruckte Sammlung als einzig verortbaren Bestandteil ein „Oratorium zu einer Kirchen-Music in der L. St. Johannis-Kirchen“ enthält, kann sich diese Bemerkung nur auf einen Lüneburger Superintendenten beziehen, der laut Kirchenverfassung als „Haupt“ des Ministeriums fungierte, nicht aber zwangsläufig mit dessen Senior identisch war. (vgl. Wiesenfeldt 2016).
Soweit nicht der am 8. Juni 1713 im Alter von 62 Jahren an „Cardialgia und Wassersucht“ dahingeschiedene Heinrich Jonathan Wehrenberg gemeint war (der bereits am Epiphaniastag 1711 auf der Kanzel von St. Johannis den ersten von mehreren „hefftigen Schlag-Flüssen“ erlitten hatte), dürfte diese Anmerkung auf Wehrenbergs Nachfolger, langjährigen Freund und Protégé Johann Christoph Jauch zielen.
Das Vorwort Behms enthält überdies an gleicher Stelle einen kurzen, kryptischen Gedanken zum kritischen Verhältnis zwischen „Politici“ und Geistlichen Herren bzgl. der gesellschaftlichen Akzeptanz des Tabakrauchens. Sie mögen als Marginalie zu den Diskussionen über BWV 515 dienen, dessen endlich(?) ermittelter Textautor kürzlich vorgestellt wurde (Vgl. Koska 2023b).
Zweifelsfrei identifizierbare Bildnisse Jauchs sind nicht bekannt. Die bis zur pseudonymen Intervention des Verfassers Anfang 2018 im deutschsprachigen Wikipedia-Artikel über Johann Christoph(er) Jauch als seitenverkehrter Ausschnitt eingebundene, vorgeblich um 1985 angefertigte Reproduktion eines etwa lebensgroßen, ohne Rahmen, Signatur und prima vista erkennbare Beischriften überlieferten, sehr schadhaften Ölportraits, welches an der Ostseite einer Kapelle im südlichen Seitenschiff der Lüneburger Johanniskirche hängt, stellt - entgegen einer Tradition im „Jauchschen Familienarchiv“ - seinen befreundeten Kommilitionen, Kollegen und Nachfolger Georg Raphel (1673-1740) dar, wie sich bei intensiver örtlicher Beleuchtung aus den Aufschriften der als Staffage abgebildeten Buchrücken ergibt, die wörtlich auch im Titel einer 1731/1747 veröffentlichten Publikation Raphels auftauchen. Zudem stimmt die dort abgebildete - inzwischen leider lückenhaft gewordene, aber erkennbar gebliebene - biblische Devise (Phil. 1, 27) nicht mit derjeningen Jauchs (Ps. 73, 24) überein. (Vgl. dazu neuerdings auch Jauchs Amtsnachfolger, Superintendent em. Dr. Christoph Wiesenfeldt, in: Lüneburger Blätter, Dezember 2018).
In Raphels 1702 abgeschlossenem Stammbuch finden sich keine Einträge von oder für Jauch, jedoch zahlreiche verfolgenswerte Hinweise auf eine frühe, (gemeinsame?) akademische Entourage.
Johann Christoph Jauch war Mitglied einer väterlicherseits aus Thüringen, mütterlicherseits aus Holstein stammenden, hernach in Norddeutschland, Sachsen und Polen florierenden, später in Teilen katholisch gewordenen, privatgenealogisch ausführlich dokumentierten Familie (vgl. Jauch 1996; 1999).
Seine am 11.8.1702 getaufte Tochter Sara Maria und die beiden Söhne Ludolph Friedrich (13.11.1698 - 23.9.1764) und Tobias Christoph (17.10.1703 - 21.1.1776) blieben offenbar ohne Nachkommen.
Zu den Nachfahren eines Neffen in achter Generation zählen ein 1953 geborener Jurist und ein 1956 geborener Medienunternehmer.
Letzte Arie der Trauerkantate für Johann Christoph Jauch
Text: Michael Christoph Brandenburg
Musik: Georg Böhm
Aufgeführt am Dienstag, 6.2.1725 in der Johanniskirche in Lüneburg.
(Weichmann V/1738)
Lebe wol, verklärte Sele!
Triumhire, reiner Geist!
Ihr indessen, matte Glieder,
Legt euch stille, stille nieder,
Bleibt in einer süssen Ruh!
Und ihr müden Augenlider
Schliest euch sanfte, sanfte zu.
Künftig wird der Tag einst kommen,
Da ihr, aus der Gruft genommen,
Auch verklährt und selig heist.
Lebe wohl, verklärte Sele!
Triumphire, reiner Geist!
BWV 111/4
Drum wenn der Tod zuletzt den Geist
noch mit Gewalt aus seinem Körper reißt
BWV 244a/12
Wenn sich Geist und Glieder scheiden..
Trauermusik für Leopold von Anhalt-Köthen zum 23./24.3. 1729, Satz 20
Text: C.F. Henrici
Bleibet nun in eurer Ruh,
Ihr erblaßten Fürsten=Glieder;
Doch verwandelt nach der Zeit
Unser Leid
In vergnügte Freude wieder,
Schließt uns auch die Thränen zu.
BWV 244/67
Ruhe sanfte, sanfte ruh
Henrici „auf und für den“ Gründonnerstag/Karfreitag 1725:
Wir setzen uns bey deinem Grabe nieder,
Und ruffen dir im Tode zu:
Ruhe sanffte, sanffte ruh!
Erquicket euch, ihr ausgesognen Glieder,
Verschlafet die erlittne Wuth;
Ruhet sanffte, sanffte ruht!
Unsre Thränen,
Werden sich stets nach dir sehnen;
Synopse (Brandenburg/Henrici)
Ihr indessen, matte Glieder,
Bleibt in einer süssen Ruh!
Schliest euch sanfte, sanfte zu.
Ihr erblaßten Fürsten-Glieder;
Bleibet nun in eurer Ruh,
Schließt uns auch die Thränen zu.
Epilog
Was ist Wahrheit?
(Pontius Pilatus; Joh 18,38 - BWV 245, 18a)
Die Wahrheit ist das Ganze!
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes)
Wenn ich die Matthäus-Passion, wenn ich große Musik höre, dann glaube ich zu wissen, dass das, was diese Musik sagt, nicht die Unwahrheit sein kann. (Theodor W. Adorno 1958)
Post Scriptum
- Wahrheit: Die Disputanten sollten sich um die Wahrheit bemühen und nicht um den Sieg.
- Vernunft: Die Disputanten sollten sich auf die Vernunft und nicht auf Emotionen oder Autoritäten berufen.
- Höflichkeit: Die Disputanten sollten sich gegenseitig mit Respekt behandeln.
(Die letzten drei Anmerkungen stellen eine zusammenfassende Übersetzung dar anhand eines KI-basierten Transkripts von J.C. Jauchs - unter seinem ehrenvollen Praesidium durch seinen Komilitonen J.D. Sasse und geleitet von seinem akademischen Betreuer J.G. Möller - auf Latein geführter, offenbar auch von höherer Stelle wohlwollend beschleunigter und philosophisch intrikat legitimierter Magisterdisputation im Auditorium Maximum der Universität Rostock am 26.10.1695.)
Technische Hinweise:
-
Die ab Februar 2024 gelegentlich eingepflegten Hinweise auf externe Anmerkungen zu einzelnen Aspekten und Begriffen tragen experimentellen Charakter. Ihre KI-basierte technische Konsistenz ist naturgemäß unverbindlich. Das gilt auch für die dort wiedergegebenen Inhalte. Gleichwohl mögen sie Rezipienten als Ausgangspunkte zum Recherchieren und Raisonnieren dienen.
-
Die entgegen üblicher Praxis mehrdeutige Verwendung von eckigen Klammern [] als Merkmal auch für Hervorhebungen statt nur für Auslassungen ist der Verwendung von Markdown als Zielformat des primär in Scrivener gepflegten Grund-Textes geschuldet.
S.D.G.
[S]ei [D]ies [G]estattet!